| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Inhaltsverzeichnisse Fontes Christiani, 3. Reihe, Brepols Verlag: eine Bibliothek von etwa 90 Bänden in bibliophiler Ausstattung | ||||||
| Reihe 1: Bände 1-21 | Reihe 2: Bände 22-40 | Reihe 3: ab Band 41 | Reihe 4: Bände 50-68 | Reihe 5 Band 69-102 | Reihe 6: ab Band 103 | Sonderbände |
| Beschreibung 1. Reihe | Beschreibung 2. Reihe | Beschreibung 3. Reihe | Beschreibung 4. Reihe | Beschreibung 5. Reihe | Beschreibung 6. Reihe | |
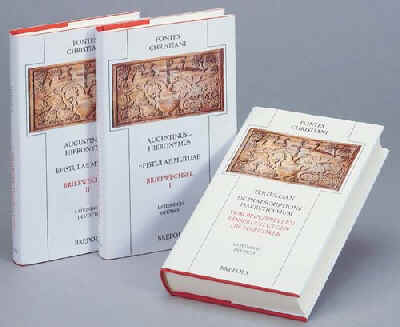 |
Der Rückblick auf die Quellen hat
in der europäischen Geschichte eine besondere Bedeutung.
Immer wieder gibt es Zeiten, in denen die Besinnung auf
Leistungen vorausliegender Epochen zur inspirierenden
Kraft neuer Bewegungen wird. Nicht antiquarisches
Interesse, sondern die Orientierung an
beispielgebenden Gestalten und die Auseinandersetzungen
mit ihren Werken stehen im Mittelpunkt der
›Fontes Christiani‹. Nach dem großen Erfolg der vom Herder Verlag herausgegebenen Reihen 1 und 2 der ›Fontes Christiani‹ ist die Planung für eine 3., weiterführende Serie abgeschlossen. Die neuen Bände der dritten Serie werden von dem namhaften wissenschaftlichen Verlag Brepols (Belgien) herausgegeben. Die Reihe ›Fontes Christiani‹ bietet in jedem Band den originalsprachlichen Text und stellt ihm eine neue deutsche Übersetzung gegenüber. Eine Einleitung, die den aktuellen Forschungsstand wiedergibt, Anmerkungen und ein Register erschließen den Zugang zu dem einzelnen Werk. Die Auswahl der Schriften trägt dem Ziel einer möglichst breiten Rezeption Rechnung. Sie umfasst 'klassische' Texte, die das Denken der jeweiligen Zeit in besonderer Weise geprägt haben. Dazu treten weniger bekannte Werke, die eine neue Erschließung und Verbreitung verdienen und erstmals eine deutsche Übersetzung erleben. Der Umfang der einzelnen Bände liegt jeweils zwischen 250 und 400 Seiten. Typographie und Satzspiegel garantieren eine hohe Lesefreundlichkeit. Für den Druck wird ein säurefreies Papier verwendet. Die Druckbogen sind mit Faden auf Gaze geheftet. Der ziegelrote Leineneinband mit Prägestempel ist durch einen vierfarbigen Umschlag besonders geschützt. |
|
|
||||
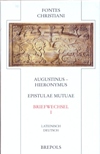 |
Hrsg. von Alfons Fürst Fontes Christiani, Band 41, 1-2 1. Bd.: 2002, 260 S. Gzl. 2. Bd.: 2002, 292 S. Gzl. |
Fontes Christiani Reihe 3, Band 41 Die Zeitgenossen Augustinus (354 - 430) und Hieronymus (um 347 - 419 / 420) sind sich persönlich nie begegnet, standen jedoch 25 Jahre lang brieflich in Kontakt miteinander. 18 von (mindestens) 26 Briefen sind erhalten und werden hier erstmals gesammelt in deutscher Übersetzung mit ausführlicher Einleitung und Erläuterungen präsentiert. Reiz und Lebendigkeit dieser Korrespondenz ergeben sich aus den höchst unterschiedlichen charakterlichen und theologischen Mentalitäten der Briefpartner. Hieronymus reagierte gereizt und aggressiv auf kritische Anfragen, Augustinus kostete es viel Mühe, das sich anbahnende Zerwürfnis sensibel und geschickt zu verhindern. Inhaltlich geht es um eine breite Palette in der Alten Kirche wichtiger Themen, unter anderem um die Bibelübersetzungen des Hieronymus, um die Herkunft der Seele des Menschen im Zusammenhang mit der Erbsündenlehre Augustins und vor allem um die exegetische Frage, ob die berühmte Auseinandersetzung zwischen Paulus und Petrus in Antiochia (Gal 2,11 - 14) ein echter oder ein fingierter Streit gewesen sei. Zusammen mit den persönlichen Querelen eröffnet die kontroverse Debatte über den Apostelstreit paradigmatische Einsichten in den christlich-kirchlichen Umgang mit Dissens und Konflikt. Alfons Fürst ist Professor für Alte Kirchengeschichte an der Universiät Münster. |
||
 |
Hrsg. von Dietrich Schleyer Fontes Christiani, Band 42 364 Seiten 978-2-503-52105-3 |
›De praescriptione
haereticorum‹, entstanden zwischen 200 und 206, ist
das grundlegende Werk Tertullians für seine
Auseinandersetzung mit gnostischen Lehren. Obwohl diese
Schrift des karthagischen Autors undenkbar wäre ohne das
vorausgehende umfangreiche antignostische Werk
›Adversus haereses‹ des Irenäus von Lyon,
stellt sie eine eigenständige Leistung dar: Durch die
Beschränkung auf einige wesentliche Gedanken seines
Vorgängers, d.h. auf formale Kriterien der
Glaubenswahrheit, gelingt es Tertullian, eine gegen alle
Häresien gerichtete, systematische und relativ kurze
Argumentation aufzubauen, die sich durch ihre rhetorische
Meisterschaft auszeichnet, sichtbar in der Prägnanz und
Präzision ihrer Formulierungen. Neben einer neuen deutschen Übersetzung liefert der Band eine ausführliche Einleitung, die die sich dem heutigen Leser stellenden vielfältigen Probleme und die gedankliche Struktur der Schrift klären soll. Dietrich Schleyer, Dr. Phil., war Oberstudienrat für Latein und Französisch in Schwelm und Wuppertal. |
||
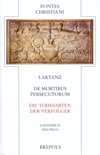 |
Hrsg. von Alfons Städele Fontes Christiani, Band 43 2003, 270 S. nicht mehr lieferbar |
Die Schrift ݆ber die
Todesarten der Verfolger‹ des L. Caelius Firmianus
Lactantius ist ein einzigartiges zeit- und
geistesgeschichtliches Dokument. Vor dem Hintergrund der
'Großen Verfolgung' unter Diokletian am Beginn des 4.
Jahrhunderts n. Chr. deutet der Autor die römische
Kaisergeschichte als Beleg für seine These, der
Christengott bestrafe die Feinde seiner Kirche stets noch
hier auf Erden, und zwar durch einen gewaltsamen, in
jedem Fall jämmerlichen Tod. Das in einer einzigen Handschrift schlecht überlieferte Werk wurde neu ediert, übersetzt und kommentiert. Für den deutschen Sprachraum liegt damit nach mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine Bearbeitung dieses vielschichtigen Pamphlets vor, in dem unter anderem ein so wichtiges Textzeugnis wie das ›Toleranzedikt von Mailand‹ der Nachwelt in seiner lateinischen Fassung erhalten blieb. Alfons Städele, Dr. Phil., war Gymnasiallehrer für Latein, Griechisch und Deutsch und seit 1975 Ministerialrat im Kultusministerium Bayern. |
||
 |
Petrus
Abaelard Scito te ipsum - Erkenne dich selbst Lateinisch Deutsch Fontes Christiani Band 44 2010, 280 Seiten |
Scito te ipsum gehört zu den wichtigsten Texten des zwölften Jahrhunderts. Erst in der späten Phase seines Schaffens entschloss sich Abaelardus, die moraltheologischen Themen aus seinem theologischen Gesamtentwurf herauszulösen und ihnen unter den Leitbegriffen von „Sünde“ (Erstes Buch) und „Gehorsam vor Gott“ (Zweites Buch, nicht ausgeführt) eine Monographie zu widmen. Als Ethica nostra sollte sie der philosophischen Ethik eine christliche Konzeption zur Seite stellen und den Ertrag seiner bisherigen Studien zusammenfassen. Mit Abaelards gesamter Theologie wurde auch diese Abhandlung von Papst Innozenz II. als häretisch verurteilt und galt lange als verloren. Seit der Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert trifft sie, auch aus philosophischer Sicht, auf reges Interesse. Dieses gilt vor allem der distinktiven Definition der Grundbegriffe Laster, Sünde, Wille und Tat sowie dem handlungstheoretischen Modell im ersten Teil des Werks. Der begriffshistorische Aspekt und die kontextuelle Einbindung in das Gesamtwerk Abaelards finden in der Einleitung zu diesem Band besondere Aufmerksamkeit, der den lateinischen Text aus dem Corpus Christianorum (CC CM 190) mit einer neuen deutschen Übersetzung darbietet. Damit liegt nach dem Römerbriefkommentar (Band 26/1, 2. Reihe) nun das zweite wichtige Werk dieses berühmten Philosophen und Theologen des 12. Jahrhunderts in den „Fontes Christiani“ vor. | ||
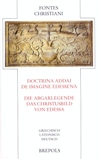 |
Hrsg. vom Martin Illert Fontes Christiani Band 45 |
Die spätantike Erzählung von der Bekehrung des Königs Abgar aus dem mesopotamischen Edessa zählt zu den am weitesten verbreiteten Legenden des byzantinischen Kulturkreises. Ein besonders vielfältiges Nachleben wurde den Episoden vom Briefwechsel des Königs mit Jesus Christus und von der Anfertigung des Christusbildes von Edessa zuteil. Der vorliegende Band bietet die wichtigsten syrischen, griechischen, lateinischen und kirchenslawischen Quellen zur Abgarlegende größtenteils erstmals in deutscher Übersetzung. | ||
 |
Alexander Monachus Laudatio Barnabae - Lobrede auf Barnabas Brepols Publishers, 2007, Gebunden, 978-2-503-52561-7 51,40 EUR Fontes Christiani Band 46 |
Alexander Monachus (Cyprius) lebte im 6. Jahrhundert als Mönch in
jenem Kloster, das in unmittelbarer Nähe von Salamis über der
angeblichen Grabstätte des
Apostels Barnabas errichtet worden war. Die Entdeckung des
Barnabasgrabes in der Regierungszeit des Kaisers Zeno und die damit
verbundene Bewahrung der kirchlichen Selbstständigkeit Zyperns steht im
Mittelpunkt der Darstellung. Als in seiner Bedeutung für die
Dogmengeschichte bislang unterschätztes Werk führt die Laudatio Barnabae
unmittelbar in die erbitterten Auseinandersetzungen um das
Glaubensbekenntnis von Chalcedon hinein und bezieht entschieden gegen
den Monophysitismus Stellung, wie er von dem die zyprische Kirche in
ihrer Unabhängigkeit bedrohenden antiochenischen Patriarchen Petrus
Fullo vertreten wird. Zudem wird eine Vielzahl apokrypher Traditionen
verarbeitet, die in erheblichem Maße zu einer Bereicherung des von der
Apostelgeschichte vermittelten Barnabasbildes beitragen. Der vorliegende Band bietet neben einer ausführlichen Einleitung und Kommentierung zum ersten Mal eine Übersetzung der Laudatio Barnabae in eine moderne Fremdsprache. Eingeleitet von Bernd Kollmann, Professor für Exegese und Theologie des neuen Testamentes an der Universität Siegen; übersetzt von Bernd Kollmann und Werner Deuse, Oberstudienrat an der Universität Siegen und Professor für klassische Philologie an der Universität Köln. |
||
 |
Ambrosius von Mailand De fide at Gratianum - Über den Glauben an Gratian Bearbeitung: Christoph Markschies |
Ambrosius (geb. ca. 333/334 in Trier, gest. 397 in
Mailand) wurde im Jahre 374 zum Bischof von Mailand gewählt. Zuvor hatte
er hohe Posten in der Zivilverwaltung bekleidet - zuletzt als
Provinzstatthalter der "Liguria Aemilia" mit Sitz in der westlichen
Kaiserresidenz Mailand. Als Bischof von Mailand entfaltet Ambrosius eine
rege schriftstellerische Tätigkeit und greift in die theologischen
Auseinandersetzungen seiner Zeit ein. Zeugnis davon gibt die
syternatisch-theologische Schrift "De fide", die in den Jahren 378-380
im Auftrag des Kaisers Gratian zunächst als zweibändiges Werk entstand,
das später um drei weitere Bücher ergänzt wurde. Ambrosius überträgt in
dieser Schrift, die auf der sorgfältigen Lektüre von Texten des
Athanasius, aber auch des Basilius beruht, die kappadozische Form des
Neunizänismus in die lateinische Terminologie und die pastorale
Situation der Mailänder Kirche. Zudem wird die homöische Theologie unter
Berufung auf zahlreiche Bibelstellen widerlegt. Ambrosius wurde lange Zeit unterschätzt und vornehmlich als ein rezipierender und kaum schöpferischer Kirchenpolitiker des vierten Jahrhunderts gesehen. Doch wird dieses negative Bild heute in vielen Punkten revidiert. Eine genaue Analyse der Schriften des Mailänder Bischofs zeigt seine hochstehende Bildung sowie seine Sensibilität und Souveränität im Umgang mit seinen Quellen und Vorlagen. Seine berühmten Hymnen (z.B. "aeterne rerum conditor") werden noch heute in der Kirche gesungen. Bemerkenswert ist die Energie, mit der Ambrosius alle Bereiche des spätantiken Bischofsamtes angeht und ausfüllt. Ambrosius ist wohl der Theologe, der (neben Damasus) die größte Bedeutung für die Durchsetzung des neunizänisch interpretierten Bekenntnisses von Nicaea (325) im Abendland hat. Die vorliegende Edition versucht einen Beitrag zur Revision des überkommenen Arnbrosius-Bildes zu leisten und damit einen neuen Zugang zu diesem wichtigen Werk des großen Kirchenvaters zu eröffnen.tät und Souveränität im Umgang mit seinen Quellen und Vorlagen. Seine berühmten Hymnen (z.B. "aeterne rerum conditor") werden noch heute in der Kirche gesungen. Bemerkenswert ist die Energie, mit der Ambrosius alle Bereiche des spätantiken Bischofsamtes angeht und ausfüllt. Ambrosius ist wohl der Theologe, der (neben Damasus) die größte Bedeutung für die Durchsetzung des neunizänisch interpretierten Bekenntnisses von Nicaea (325) im Abendland hat. Die vorliegende Edition versucht einen Beitrag zur Revision des überkommenen Arnbrosius-Bildes zu leisten und damit einen neuen Zugang zu diesem wichtigen Werk des großen Kirchenvaters zu eröffnen. |
||
|
Band 1
Brepols Publishers, 2005, Gebunden, 978-2-503-52133-6 Fontes Christiani Band 47 |
||||
| Band 2 Brepols Publishers, 2005, Gebunden, 978-2-503-52135-0 Fontes Christiani Band 47 |
||||
| Band 3 Brepols Publishers, 2005, Gebunden, 978-2-503-52141-1 Fontes Christiani Band 47 |
||||
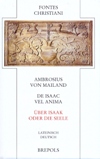 |
Hrsg. von Ernst Dassmann 978-2-503-52111-4 Fontes Christiani, Band 48 2003, 185 S. |
In der reichhaltigen literarischen
Hinterlassenschaft des Bischofs Ambrosius von Mailand
(† 397) gilt die späte Schrift "De Issac vel
Anima" als ein herausragendes Werk, das die
spätantike und frühmittelalterliche Spiritualität und
Askese nachhaltig beeinflußt hat. Sie legt beredtes
Zeugnis vom Rang der ambrosianischen Theologie ab, die
von einer exegetischen und dogmatisch sorgfältig
begründeten "Jesusfrömmigkeit" geprägt ist.
Ambrosius vermittelt in ihr die Hoheliedauslegung des
berühmten Alexandriners Origenes ins Abendland und die
Grundgedanken der neuplatonischen Philosophie in die
christliche Theologie. "De Isaac vel Anima"
wird hier zum ersten Mal in deutscher Übersetzung
geboten. Sie kann helfen, neben der immer schon
anerkannten kirchenpolitischen und pastoralen Kompetenz
des Mailänder Bischofs sich auch von seiner
frömmigkeitsgeschichtlichen Bedeutung einen Eindruck zu
verschaffen. Ernst Dassmann war Professor (em.) für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie an der Universität Bonn sowie Direktor des Franz Joseph Dölger-Insituts Bonn. |
||
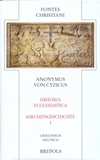 |
Anonymus von
Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte Band 1 Griechisch Deutsch Brepols Publishers, 2008, 300 Seiten, Gebunden, 978-2-503-51923-4 45,90 EUR |
Fontes Christiani Band 49 Der früher durch Verwechslung mit Gelasius von Caesarea als Gelasius von Cyzicus benannte Verfasser einer Kirchengeschichte der Zeit Konstantins in drei Büchern hat nach 475 mit orthodoxem Eifer, aber ohne Plan und Kritik und ohne literarisches Talent ein Werk kompiliert, in dem Stücke aus den Kirchengeschichten des Eusebius, Gelasius von Caesarea, Theodoret, Socrates, alle mit redundanten Zusätzen, um die Reste einer romanhaften Darstellung des Konzils von Nicaea (unter anderem eine Predigt Konstantins, die Disputation mit einem arianischen Philosophen, Teile einer sonst unbekannten Kirchenordnung) gruppiert sind. Herkunft und Interpretation dieser umfangreichen Reste sind noch nicht genügend geklärt. Aufmerksamkeit verdient das Werk auch deswegen, weil es Teile der Kirchengeschichte des Gelasius von Caesarea wörtlich übernommen hat. Zu den Vorlagen gehört nach der Meinung des Editors auch die Christliche Geschichte des Philippus von Side. Die Ausgabe des griechischen Textes und die zu seinem Verständnis nützliche erste Übersetzung in eine moderne Sprache wollen die Erschließung eines wenig beachteten Quellenwerks fördern. |
||
| Anonymus von Cyzicus Historia ecclesiastica - Kirchengeschichte Band 2,. Griechisch Deutsch Brepols Publishers, 2008, 300 Seiten, Gebunden, 978-2-503-51925-8 51,40 EUR |
||||
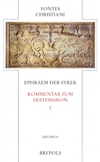 |
Expositio Evangelii concordantis - Diatessaronkommentar Bearbeitet von Dr. Christian Lange. Fontes Christiani, Band 54 1+2 |
Im Gegensatz zur griechisch- und lateinischsprachigen Christenheit des Westens, verwendeten die syrischen Christen bis ins 5. Jahrhundert eine Harmonie der vier Evangelien als Hauptschrift des Neuen Testamentes, das sognannte Diatessaron: Da nach heutigem Wissensstand kein syrisches Manuskript dieser Evangelienharmonie erhalten ist, kommt dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckten und Ephraem dem Syrer (ca. 306-373) zugeschriebenen syrischen Diatessaronkommentar eine wichtige Rolle bei der Erforschung der frühen syrischen Textgestalt der Evangelien zu - und das, obwohl die Zuweisung zu Ephraem in der Forschung umstritten und das Werk zum Teil nur in armenischer Übersetzung erhalten ist. Durch die Übertragung der derzeit bekannten syrischen Fassung des Kommentars stellen die Fontes Christiani diesen für Exegeten wie Historiker gleichermaßen bedeutsamen Text einem breiteren Publikum vor. | ||
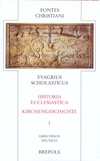 |
Evagirus Scholasticus Historia Eccelsiastica Kirchengeschichte I Griechisch Deutsch Brepols Publishers, 2007, Gebunden, 978-2-503-51975-3 53,40 EUR |
Fontes Christiani,
Band 57
1+2 Die Kirchengeschichte des Evagrius Scholasticus (536 - ca. 594), der als Rechtsberater seines Bischofs in Antiochien (Syrien) lebte und sein Werk in den 90er Jahren des 6. Jahrhunderts verfaßte, ist die letzte griechisch geschriebene Kirchengeschichte der Spätantike. Sie enthält nicht nur Urkunden und Briefe, die nirgendwo sonst überliefert sind, sie ist auch die wichtigste und oft einzige Quelle für die Zeit der Auseinandersetzungen zwischen Monophysiten und Dyophysiten nach dem Konzil von Chalcedon. Darüber hinaus bietet sie interessante Einblicke in Mönchsleben, in Volksfrömmigkeit und Alltagsleben des 6. Jahrhunderts und enthält auch wertvolles Material für die politische Geschichte. Dennoch blieb sie, da in einem zwar an antiken Vorbildern orientierten, aber anspruchsvollen und schwierigen Stil geschrieben, weitgehend unbekannt. Die nun erstmals in deutscher Sprache vorliegende vollständige Übersetzung macht das Werk für jedermann leicht zugänglich. |
||
| Evagirus Scholasticus Historia Eccelsiastica Kirchengeschichte II Griechisch Deutsch Brepols Publishers, 2007, Gebunden, 978-2-503-51977-7 59,40 EUR |
||||
 |
Hrsg. von Siegfried Risse Fontes Christiani, Band 60 2003, 250 S. 978-2-503-51441-3 51,40 |
Unter den zahlreichen exegetischen
Arbeiten des Hieronymus (um 347 - 419/420) gehört der
Kommentar zum Propheten Jona, entstanden im Jahre 396, zu
den ausgereifteren Werken. Ausgehend von einem Vergleich
der hebräischen Textfassung mit dem Text der Septuaginta
kommentiert Hieronymus die Geschichte von Jona und dem
Seeungeheuer Vers für Vers und überliefert nicht nur
für die Auslegung dieses Buches wichtige Einzelheiten,
sondern er vermittelt uns auch eine Fülle von
kulturhistorisch relevanten Informationen. Das
alttestamentarische Rettungsparadigma des Propheten Jona
war im Bewusstsein der frühen Kirche tief verwurzelt und
ein beliebtes Motiv der frühchristlichen
Katakombenmalerei und Sarkophagplastik. Daher ist der
Jonakommentar auch von großer Bedeutung für die
kunsthistorische Forschung und wird hier zum ersten Mal
in einer deutschen Übersetzung präsentiert. Neben einer
ausführlichen Einleitung vertiefen zahlreiche
erläuternde Anmerkungen das Verständnis von Text und
Übersetzung. Siegfried Risse, Dr. theol., war Berufsschulpfarrer und Oberstudienrat in Essen. |
||
 |
Hrabanus Maurus De institutione clericorum - Über die Unterweisung der Geistlichen Lateinisch Deutsch Brepols Publishers, 2006, 345 Seiten, Gebunden, Fontes Christiani, Band 61, 1+2 |
Hrabanus Maurus (gest. 856), Mönch und Abt im Kloster Fulda und
schließlich Erzbischof von Mainz, erläutert in seiner "Institutio
clerico rum" die Aufgaben und Pflichten der Geistlichen. Dabei ist das
Werk weit mehr als eine allgemeine Gelegenheitsschrift zur Hebung
klerikaler Bildung. Vielmehr spiegelt es aktuelle
Informationsbedürfnisse, Wissensdefizite und Forderungen jener Zeit
wider und ist eine Reaktion auf die Reformpolitik Ludwigs des Frommen,
zu deren Umsetzung es beitragen will. Beruhend auf der neuen kritischen Edition des Verfassers wird die "Institutio clericorurn" hier erstmals vollständig in deutscher Übersetzung vorgelegt. Der beigefügte Kommentar verdeutlicht, wie virtuos Hrabanus die von ihm verwendeten Quellen für seine Zwecke umfunktioniert. |
||
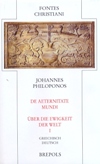 |
De aeternitate mundi - Über die Ewigkeit der Welt Bearbeitet von Prof. Clemens Scholten, Griechisch Deutsch Fontes Christiani, Band 64, 5 Bände |
Die Schrift De aeternitate mundi
des Johannes Philoponos (circa 490 - circa 575),
entstanden nach 529, ist die wichtigste und
umfangreichste christliche Stellungnahme der Antike, die
den Glauben an die Erschaffung der Welt aus Nichts und
deren zeitlichen Anfang verteidigt und begründet. Es
handelt sich um eine Widerlegung der 18 Argumente des
Neuplatonikers Proclus (gestorben 485) fEwigkeit der
Welt. Mittels wissenschaftlicher Methodik emanzipiert ür
die sich christliches Denken in den Debatten der
heidnischen Philosophenschule Alexandriens von den
Autoritäten Plato und Aristoteles. Die methodische
Präzision ist bis dahin unerreicht, die Gesichtpunkte
sind hphilosophiegeschichtliche Fundgrube ist der Text
unerschöpflich. Die Diskussionen um die äufig neu, als
Ewigkeit der Welt in der arabischen Philosophie und im
lateinischen Mittelalter fußen in der Sache
weitestgehend auf dieser Schrift. Damit liegt nach dem
Kommentar zum biblischen Schöpfungsbericht (De opificio
mundi) nun ein zweites epochales Werk des Johannes
Philoponos zum ersten Mal überhaupt in eine
öpfungsbericht moderne Sprache übersetzt vor. Der Bearbeiter, Clemens Scholten, ist Professor für Historische Theologie an der Universität zu Köln |
||
 |
Rupert von
Deutz Commentaria in Canticum Canticorum - Kommentar zum Hohenlied 1 2-503-52143-6 978-2-503-52143-5 55,40 |
Band 70
Fontes Christiani, Brepols Verlag Rupert von Deutz (ca. 1075-1129), erzogen und ausgebildet im Benediktinerkloster Saint-Laurent in Lüttich, wurde nach zeitweiligem Aufenthalt im Kloster St. Michael in Siegburg 1120 zum Abt von St. Heribert in Deutz gegenüber Köln erhoben. Rupert hinterließ ein umfangreiches theologisches Werk. Um 1110/1112 entstand sein liturgisches Frühwerk "De divinis officiis". Nach weiteren umfangreichen exegetischen Werken wie z.B. "De sancta Trinitate et operibus eius" und "De gloria et honore Filii hominis super Mattheurn" verfaßte Rupert um 1125 auf Bitten seines Freundes, des Abtes Kuno von Siegburg, einen Kommentar zum Hohenlied. Ruperts Auslegung des "Canticum Canticorum" fügt sich zwar einerseits in die tausendjährige Geschichte der christlichen Deutung des alttestamentlichen Textes ein, setzt aber andererseits insofern einen neuen Akzent, als er in den Gestalten des Bräutigams und der Braut nicht nur Christus und die Kirche sowie Christus und die Einzelseele sieht, sondern das gesamte "Canticum Canticorum" als Gespräch zwischen Christus und Maria versteht und ihm entsprechend den Titel "De incarnatione Domini" gibt, seine Exegese damit also einem einheitlichen Gesichtspunkt unterordnet. Diese marianische Interpretation des Hohenliedes, die die "Menschwerdung des Herrn" in den Mittelpunkt rückt, wirkte über das Mittelalter hinaus weit in die Zukunft hinein. Damit wird nach seinem Frühwerk "De divinis officiis", das bereits in den Fontes Christiani (Bd. 33/1-4) erschienen ist, das zweite Werk Ruperts von Deutz erstmals ins Deutsche übersetzt. |
||
| Rupert von Deutz Commentaria in Canticum Canticorum - Kommentar zum Hohenlied 2 2-503-52145-2 978-2-503-52145-9 53,40 |
||||
 |
Übersetzt und eingeleitet von Günther Christian Hansen Fontes Christiani, Bände 73/1 bis 73/4 Teilband I 2004, 331 S 978-2-503-52125-1 Teilband II 2004. V, 334 S. 978-2-503-52127-5 Teilband III 2004. (IV)V, 282 S. 978-2-503-52129-9 53,40 Teilband IV 2004. (IV)V, 217 S 978-2-503-52137-4 51,40 |
Salamanes Hermeias Sozomenos (etwa
380-445) stammte aus einer christlichen Familie in der weithin noch
altgläubigen Umgebung von Gaza. Seine geistliche und die elementare
weltliche Bildung verdankte er angesehenen Eremiten im Umkreis seines
Heimatortes Bethelea. Von der tiefen Wirkung dieser Sozialisation zeugt
der warme Ton, mit dem er in einem schönen Kapitel im ersten Buch seines
Werkes die "mönchische Philosophie" rühmt. Die griechische Literatur
lernte er durch intensive eigene Lektüre kennen. Rhetorik und Recht
studierte er wohl in Beirut. Nach 425 siedelte er nach Konstantinopel
über, wo er bei Gericht als Anwalt tätig war. In der Hauptstadt verfaßte
er auch eine "Kirchengeschichte" der
Zeit von 324 bis um 422 in neun Büchern, von denen das letzte nur ein
unvollendeter Entwurf ist. Neben auch uns bekannten Quellen (z. B.
Sokrates, Rufin, Euseb, Athanasius, Mönchsgeschichten, syrischen
Märtyrerakten) benutzte er unter anderem die "Sammlung der Synodalakten"
des Sabinus und zahlreiche Urkunden, so' daß sein Werk für den
Historiker von großem Gewicht ist. Ganz eigenständig ist sein Bestreben,
die Gattung der "Kirchengeschichte" aus ihrer ursprünglichen Bindung an
die Chronistik zu lösen und der klassischen Geschichtsschreibung
anzunähern. Die zweisprachige Ausgabe bietet einen (nach Bidez / Hansen)
verbesserten Text und die erste deutsche Übersetzung der interessanten
Geschichtsquelle. Prof. Dr. Günther Christian Hansen ist ehemaliger Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. |
||
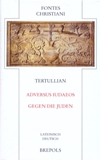 |
Tertullian Adversus Iudaeos - Gegen die Juden Brepols Publishers, 2007, Gebunden, 978-2-503-52265-4 59,40 EUR |
Fontes Christiani,
Band 75
In der lateinischen Kirche beginnt die harsche Ablehnung der Juden schon mit dem ersten lateinisch schreibenden Theologen, mit Tertullian (ca. 160-220). Bereits am Ende des 2. Jahrhunderts entwickelt er in seiner Schrift gegen die Juden eine Argumentation, die durch die Zurückweisung des jüdischen Irrtums zur Herausbildung eines christlichen Gesetzesverständnisses führt. Der Text spiegelt in besonderer Weise das Problem gleichzeitiger Abgrenzung und Akkulturation der frühen Christen im Spannungsfeld zwischen einem pagan-rörnischen, jüdischen und christlichen Gesetzesverständnis wider. Das Alte Testament bildet die Folie für eine Zurückweisung der Juden zugunsten eines christlichen Absolutheitsanspruchs. Damit steht Tertullian programmatisch am Beginn der christlichen Adversus-Iudaeos- Literatur. Zum ersten Mal liegt mit diesem Band eine vollständige deutsche Übersetzung des Textes vor. Die umfassende Einleitung macht sowohl die gedankliche Struktur als auch den zeitgeschichtlichen und literarhistorischen Kontext der Schrift sichtbar. Sie zeigt, daß dieses Werk nicht nur traditions geschichtlich zur Aufarbeitung und zum Verständnis des christlichen Antisemitismus beiträgt, sondern auch wichtige Gesichtspunkte für aktuelle Diskussionen erschließt.. |
||
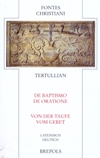 |
Tertullian / Achleyer De baptismo / De oratione - Von der Taufe / Vom Gebet Brepols Publishers, 2006, Gebunden, 978-2-503-52115-2 55,40 EUR |
Fontes Christiani Band 76 Aus der Zeit der frühen Kirche ist Tertullians Schrift "De baptisrno" die einzige uns vollständig erhaltene Schrift über die Taufe. Sie bietet wertvolle, grundlegende Informationen über die Theologie und Liturgie der christlichen Initiation in der karthagischen Gemeinde des ausgehenden zweiten Jahrhunderts und darüber hinaus der frühen Kirche. Deshalb ist sie von bleibender, hoher Bedeutung. In einem theologischen Zusammenhang mit der Schrift "Über die Taufe" steht die Auslegung des Vaterunsers, die uns in der Schrift "De oratione" desselben Autors erhalten ist. Sie ist nicht nur die älteste der erhaltenen Auslegungen, sondern auch wegen ihrer Eigenart gegenüber späteren Auslegungen der Alten Kirche und ihrer Nachwirkungen wegen (etwa bei Cyprian und Augustin) von großem Interesse. Der Band liefert neben einer ausführlichen Einleitung eine neue deutsche Übersetzung mit zahlreichen Anmerkungen. |
||
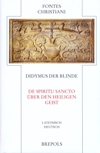 |
Übersetzt und eingeleitet von Hermann Josef Sieben Fontes Christiani, Band 78 978-2-503-52139-8 2004. 301 S. |
Didymus (geboren 310 oder 313 in Alexandria) verliert in früher
Kindheit sein Augenlicht, ohne zuvor Lesen oder Schreiben gelernt zu
haben. Trotz seiner Blindheit eignet er sich nur durch Hören und
Memorieren eine umfassende Kenntnis sämtlicher Disziplinen der artes
liberales sowie der Philosophie an. Dabei soll er eine Art
Blindenschrift erfunden haben. Nach Rufin wurde er von Athanasius als
Lehrer in der alexandrinischen Katechetenschule eingesetzt. Seine
Vorlesungen zogen Schüler von weit her an und wurden von Stenographen
mitgeschrieben. Er führte ein asketisches Leben und soll auch von
Antonius dem Großen in seiner Zelle besucht worden sein. Zu seinen
bekanntesten Schülern gehören Hieronymus, Palladius, Rufin und der
Einsiedler Ammonius. Er stirbt gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Seine
Zeitgenossen nannten ihn wegen seiner hervorragenden Gelehrsamkeit "der
Sehende". Erst nachdem Didymus als Anhänger des Origenes posthum durch
das 5. allgemeine Konzil (553) verurteilt worden war, erhielt er den
Beinamen "der Blinde". Im 9. Jahrhundert wird Didymus von den
karolingischen Theologen rehabilitiert und in die Phalanx der Zeugen
zugunsten des Filioque eingereiht. Seitdem werden seine Schriften im
Westen immer wieder zitiert. Didymus' Werk ist infolge der Verurteilung nur fragmentarisch überliefert. Sein Hauptinteresse galt der biblischen Exegese, doch verfaßte er auch wegweisende dogmatische Werke. Nachdem man Didymus die Verfasserschaft für das Werk "De trinitate", das früher unter seinem Namen überliefert wurde, abgesprochen hat, ist die Schrift "De spiritu sancto" - unbestritten in der Echtheit - aus dem Schatten von "De trinitate" hervorgetreten und giit heute als seine wichtigste dogmatische Abhandlung. Abgefaßt wurde die Schrift vielleicht schon zwischen 355 und 358, doch neigt man traditionell eher zu einer Spätdatierung zwischen 370 und 375. Sie wurde nach 385 von Hieronymus ins Lateinische übersetzt und ist in dieser Übersetzung vollständig erhalten. Ambrosius lag bei der Abfassung seiner Schrift "De spiritu sancto" im Jahre 381 das Werk des Didymus vor. In Ubereinstimmung mit Athanasius betont Didymus die Homoousie in der Trinität, in die der Heilige Geist einbezogen wird. Dabei ist Didymus vor allem an den biblisch-exegetischen Grundlagen der Pneumatologie und Trinitätslehre interessiert. Von Bedeutung ist dieser Text aber nicht nur für die Geschichte der Pneumatologie, sondern auch für die Biographie des Kirchenvaters. Das Werk gilt heute nicht mehr als sein erster Versuch einer Abhandlung über den Heiligen Geist, um diesen Versuch dann 20 oder 30 Jahre später noch einmal aufzugreifen und zu einem befriedigenden Abschluß zu bringen, sondern vielmehr als sein abschließendes Wort zu dieser Problematik. Nach einer ausführlichen Einleitung wird der lateinische Text von "De spiritu sancto" im vorliegenden Band zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. |
||
 |
Hieronymus Risse Commentarioli in Psalmos - Anmerkungen zum Psalter Brepols Publishers, 2005, Gebunden, 978-2-503-52155-8 51,40 EUR Fontes Christiani Band 79 |
Die Commentarioli in Psalmos hat Hieronymus (um 347 - 419/420)
wahrscheinlich auf Bitten einer der Frauen aus seiner Umgebung etwa
386-388 geschrieben. Der Reiz dieser Psalmenerklärung besteht darin, dass es sich nur um kurze Notizen handelt. Dadurch verlangt sie vom Leser mehr eigenes Nachdenken als die ausführlicheren Kommentare. Der Leser wird nicht am Text der Psalmen entlang geführt, sondern jeweils nur an eine bestimmte Stelle gesetzt und muss sich mit Hilfe der kurzen Notiz den Kontext erschließen. Hieronymus vergleicht sein Vorgehen mit dem der Kartographen, die mit wenigen Strichen und Zeichen die Lage von Ländern und Städten auf einer kleinen Tafel darstellen und damit einen Überblick über ausgedehnte Gebiete geben. Ebenso sollen seine kurzen Anmerkungen einen Überblick geben über den gesamten Psalter. Die Commentarioli bieten jedoch nicht nur Erklärungen zum Verständnis der Psalmtexte, sondern auch Hinweise auf das theologische Denken und die Auseinandersetzung mit den Häretikern dieser Zeit. Im 5. bis 8. Jahrhundert wurden die Commentarioli mit Psalmerklärungen anderer Herkunft zu einem neuen Werk verarbeitet. Ihre ursprüngliche Fassung wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. Sie werden hier zum ersten Mal in eine moderne Fremdsprache übersetzt. Inhaltsverzeichnis |
||
 |
Georg Röwekamp Pamphilus von Caesarea, Apologie für Origenes - Apologia Pro Origene Lateinisch Deutsch Brepols Publishers, 2006, 484 Seiten, Gebunden, 978-2-503-52147-3 59,40 EUR |
Fontes
Christiani Band 80 Pamphilus, geboren in Berytus (Beirut), studierte in der zweiten Hälfte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts in der kirchlichen Hochschule (Didaskaleion) in Alexandrien, deren Leitung der Origenes-Schüler Pierius innehatte, und wurde so mit dem Erbe des Origenes vertraut. Im Jahre 307 n.Chr. wurde Pamphilus, der mittlerweile nach Caesarea in Palästina übergesiedelt und zum Presbyter geweiht worden war, inhaftiert. Er starb als Märtyrer unter der Herrschaft des Kaisers Maximinus Daia am 16. Februar 310. Im Gefängnis verfasste Pamphilus zusammen mit seinem Schüler Eusebius von Caesarea, dem später berühmt gewordenen Kirchenhistoriker, eine Apologie in sechs Büchern für Origenes, die vielleicht umstrittenste und faszinierendste Persönlichkeit der frühen Kirche. Die ersten fünf Bücher wurden von Pamphilus und Eusebius gemeinsam verfasst. Der dem Werk vorgeschaltete Einleitungsbrief des Pamphilus wendet sich an die Bekenner, die im Zuge der Christenvedolgungen zur Arbeit in den Bergwerken Palästinas verurteilt worden waren. Von dem Werk sind nur dieser Brief und das erste Buch erhalten, und zwar in der lateinischen Übersetzung des Rufin von Aquileia. Überliefert ist es zusammen mit einem Vorwort des Rufin und dessen Schrift Über die Fälschung der Bücher des Origenes. Das Buch selbst besteht aus einer Sammlung von Origenes-Zitaten, die die Rechtgläubigkeit des Origenes gegenüber den Anschuldigungen der Gegner im ersten Origenistenstreit beweisen sollen. Problematisiert werden zentrale Fragen der frühen christlichen Lehre: das Verhältnis von Vater, Sohn und Heiligem Geist, die Menschwerdung Christi, das Schriftverständnis, die Auferstehung, die Bestrafung der Sünder, die Präexistenz der Seele sowie die Seelenwanderung. Der vorliegende Band präsentiert den Text des Pamphilus in der lateinischen Übertragung Rufins zum ersten Mal in einer deutschen Übersetzung nebst der Schrift des Rufin über die Fälschung der Bücher des Origenes. Die vielfältigen Fragen, die dieser Text im Streit um Origenes aufwirft, werden in der Einleitung ausführlich behandelt. |
||
 |
Fontes Christiani, 2009
|
Fontes Christiani Band 81, Das Ideal der Jungfräulichkeit wurde von den Anfängen des Christentums an hochgeschätzt. Ambrosius faßt mit seiner Schrift "De virginibus" die große Tradition des Virginitätsideals zusammen. Das 377 verfaßte Werk stützt sich auf die Vorstellung von der Jungfräulichkeit, so wie Origenes sie formuliert hat. Für Ambrosius ist das jungfräuliche Leben "engelgleich" und bezieht sich auf Christus als Urbild der Virginität. Damit hebt sich das christliche Jungfräulichkeitsideal von vergleichbaren heidnischen Lebensformen wie dem Vestalinnenkult ab. Der hohe Stellenwert dieser Lebensweise beruht aber nicht allein auf dem Charakter der Übernatürlichkeit, sondern auch auf dem Vergleich der Jungfrau, die als Braut Christi betrachtet wird, mit der Gottesmutter Maria. Die vorliegende Ausgabe enthält einen neuen kritischen Text und eine modernen Ansprüchen angepaßte Übersetzung. |
||
 |
Heinz Ohme Concilium Quinisextum - Das Concilium Quinisextum Lateinisch Deutsch Brepols Publishers, 2006, 300 Seiten, Gebunden, 978-2-503-52455-9 |
Fontes Christiani
Band 82 Die 102 Kanones des Concilium Quinisextum stellen den Höhepunkt und die Kodifizierung des altkirchlichen Kirchenrechtes dar. Mit der Konstantinopeler Synode, die sie im Jahre 691/692 erließ, werden sie in den orthodoxen Kirchen zur "Heiligen Tradition" der Sieben Ökumenischen Synoden gerechnet. Keine andere Synode der Alten Kirche hat in so umfangreicher Weise Recht gesetzt. Alle Bereiche des kirchlichen Lebens werden in diesen Bestimmungen einer Revision unterzogen. Es wird der Versuch unternommen, auf dem Wege des Kirchenrechtes eine Neuordnung des kirchlichen Lebens zu erreichen. So sollte der Grundlagenkrise des 7. Jahrhunderts begegnet werden, in der der Bestand des Byzantinischen Reiches akut gefährdet war. Das Spektrum der Maßnahmen umfaßt die Abwehr heidnischer Lebensformen und häretischer Praktiken, Detailbestimmungen zur Heiligung des Gottesvolkes, zur Unterscheidung von Heilig und Profan und zur gottesdienstlichen Praxis genauso wie zu Grundsatzfragen der Kirchenverfassung, des Klerikerrechtes und des Mönchtums. Viele Bestimmungen sind wirkungsgeschichtlich höchst bedeutsam für die konfessionelle Ausprägung der orthodoxen Kirchen, deren Tradition bisweilen absolut gesetzt wird. So wurde diese Synode ab dem 11. Jahrhundert auch zu einem Dauerthema kontroverstheologischer Polemik zwischen griechischem Osten und lateinischem Westen. Der vorliegende Band bietet erstmals eine moderne deutsche Übersetzung und kritische Kommentierung der Kanones. |
||
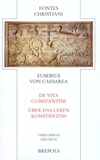 |
De vita Constantini - Über
das Leben Konstantins Brepols Publishers, 2007, Gebunden, 978-2-503-52559-4 |
Fontes Christiani Band 83 Die Vita Constantini des Eusebius von Caesarea (ca. 260-339 n. Chr.), des Vaters der Kirchengeschichtsschreibung, gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Quellen zu Konstantin dem Großen, zumal sie in engem zeitlichen Abstand zu Konstantins Tod im Jahre 337 n. Chr., in Teilen wohl noch zu dessen Lebzeiten verfaßt wurde. Euseb feiert in dieser vier Bücher umfassenden Schrift den ersten christlichen Kaiser in der Geschichte Roms nach den Regeln des antiken Herrscherlobs und erweitert dieses außerdem noch durch die Zugabe authentischer Urkunden aus der kaiserlichen Kanzlei sowie eigenhändig abgefaßter Schreiben des Kaisers. Konstantin ist in der Darstellung Eusebs ein Diener Gottes wie Mose und zeichnet sich durch seine Frömmigkeit und seinen Glauben an den einen Gott aus, den er nicht müde wird zu verkünden, während die polytheistische Religion der paganen Dämonenverehrer von ihm bekämpft wird. Obwohl Euseb den Kaiser persönlich nur wenige Male treffen konnte, zeichnet er dessen berühmte Vision des Labarums, das heißt des christlichen Feldzeichens, nach dessen Bericht auf. Desweiteren berichtet er von der Schlacht an der Milvischen Brücke, beschreibt die kaiserlichen Baumaßnahmen, wie zum Beispiel den Bau der Grabeskirche in Jerusalem oder die Apostelkirche in Konstantinopel, und schildert den Tod von Konstantins Vater Constantius Chlorus ebenso wie den seiner Mutter Helena. Erst auf dem Totenbett läßt sich Konstantin nach Euseb taufen und erweist sich in seinem Tod als glücklich zu preisender Mensch, der mit Söhnen, die seine Nachfolge antreten können, gesegnet ist, der sich der Verehrung seiner Untertanen gewiß sein kann und durch viele militärische Erfolge ebenso wie durch kluge politische Maßnahmen sein Konzept der Einheit in Staat und Kirche erfolgreich verwirklicht hat. Das Bild Konstantins, das Euseb bietet, zeigt diesen als Idealtyp eines christlichen Herrschers, der sich durch seine Fürsorge für alle Untertanen, seine asketisch gelebte Frömmigkeit sowie durch seine Verbundenheit mit Gott in Glauben und Gebet auszeichnet. Der vorliegende Band bietet neben einer ausführlichen Einleitung, in der die aktuelle Forschungslage dargestellt wird, eine moderne deutsche Übersetzung mit kommentierenden Fußnoten und schließt so eine Forschungslücke im deutschsprachigen Raum. |
||
 |
Prudentius Contra Symmachum - gegen Symmachus Lateinisch Deutsch Brepols Publishers, 2008, 400 Seiten, 12,5 x 19,5 cm Gebundene Ausgabe 978-2-503-52948-6 51,40 EUR |
Fontes Christiani Band 85 Mit seinem Gedicht Contra Symmachum wendet sich Prudentius (348 - nach 404 n. Chr.), der bedeutendste christliche Dichter der Spätantike, gegen einen herausragenden Repräsentanten des spätantiken Heidentums. Als Präfekt der Stadt Rom hatte Symmachus 384 mit einer Petition versucht den Kaiser dazu zu bewegen, den Altar und die Statue der Victoria, die aus dem Senat entfernt worden waren, dort wieder aufzustellen. Ins Zentrum seiner Petition rückte er den Gedanken, es sei nur recht und billig, wenn "jenes, das alle verehren, für ein und dasselbe gehalten" werde. Zu einem so "erhabenen Geheimnis" könne man aber "nicht auf einem einzigen Weg gelangen". Ziel dieser Argumentation war es, den Angriff der Christen auf den römischen Götterkult abzuwehren. Den rhetorischen Höhepunkt bildete eine der Roma (der personifizierten Stadt Rom) in den Mund gelegte Klage, es sei eine Schmach, noch in solch einem ehrwürdigen Alter von über tausend Jahren zurechtgewiesen zu werden. Der Bischof Ambrosius von Mailand stemmte sich mit Erfolg gegen den Antrag. Da aber die heidnische Senatsopposition aktiv blieb, sah sich Prudentius einige Jahre später veranlaßt, dem Symmachus zu antworten. Prudentius beschränkte sich nicht darauf, gegen den heidnischen Götterkult zu polemisieren und die Argumente des Symmachus zurückzuweisen, er entwarf auch ein Geschichtsbild, das in der historischen Entwicklung Roms göttliche Providenz am Werke sein läßt: Gott habe Rom die Aufgabe zugewiesen, die in Kriege verstrickten und durch Sprache und Kultur getrennten Völker der Erde zu Frieden und Einheit zu führen und so die Annahme des christlichen Glaubens überhaupt erst zu ermöglichen. Der Dichter läßt Roma erklären, daß sie erst durch ihre Bekehrung zum Christentum Anspruch auf die allgemeine Verehrung habe. Mit Prudentius' Gedicht war der Streit um den Altar der Victoria unwiderruflich beendet. Der renommierte klassische Philologe Hermann Tränkle hat den lateinischen Text ins Deutsche übertragen und erläutert. In einem Anhang ist auch die Petition des Symmachus (Relatio 3) beigegeben |
||
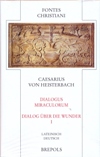 |
Caesarius von Heisterbach: Dialogus
Miraculorum - Dialog über die Wunder , 5 Bände, zwischen 400 und 550 Seiten |
Fontes Christiani, Band 86 Caesarius von Heisterbach, circa 1180 in Köln geboren uind dort aufgewachsen, wurde 1199 Mönch im Zisterzienserkloster Heisterbach im Siebengebirge. Später dort Novizenmeister und 1222 Prior, starb er circa 1246. Sein Hauptwerk, der Dialogus miraculorum enthält über 800 Kurzgeschichten (Exempla), die Caesarius nach zwölf Themenkreisen (Distinctiones) geordnet hat. Die Beliebtheit seiner Sammlung zeigt sich insbesondere darin, daß mehr als hundert mittelalterliche Handschriften seines Dialogus bekannt sind. Um das Werk verständlicher zu präsentieren, hat Caesarius die einzelnen Exempla in eine Dialogform eingekleidet. Als Personen des Dialogs treten ein Mönch in der Rolle des Novizenmeisters und ein Novize auf. Beide bleiben anonym, doch tritt hinter dem Mönch die Gestalt des Caesarius selbst hervor. Caesaritis fängt in seinein Dialogus miraculorum die bunte und facettenreiche Welt zu Beginn des 13. Jahrhunderts wie in einem Kaleidoskop ein; so werden unter anderem thematisiert: der Zauberer Merlin und die Artussage, berühmte historische Persönlichkeiten wie Thomas Becket, Friedrich II., Richard Löwenherz oder Sultan Saladin, vagabundierende Kleriker und Bettelpoeten, im Konkubinat lebende Priester, Legenden um die Tempelritter; die Plünderung Konstantinopels 1204 und die Kreuzzüge, die Flutkatastrophe von Friesland, Teufels- und Dämonenbeschwörungen, wunderbare Luftreisen und Marienvisionen, das ritterliche Turnier, Reliquienkult und Judenhaß, aber auch der harte klösterliche Alltag. Eine wissenschaftliche Einleitung, kommentierende Fußnoten und ausführliche Register ergänzen die erste vollständige moderne Übersetzung ins Deutsche. Band 1 enthält die Einleitung, Inhaltsverzeichnis (Index Capitulorum) und die ersten beiden Distinktionen (De conversione, De contritione). Band 2 die Distinktionen 3 und 4 (De confessione, De tentatione), Band 3 die Distinktionen 5-7 (De daemonibus, De simplicitate, De sancta Maria), Band 4 die Distinktionen 8-10 (De visionibus, De corpore Christi, De miraculis), Band 5 die Distinktionen 11 und 12 (De morientibus, De praemio mortuorum) sowie Bibliographie und Register. Nikolaus Nösges ist Pfarrer im Ruhestand in Essen. Horst Schneider ist Privatdozent für Byzantinische und Neugriechische Philologie und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Arbeitsstelle Fontes Christiani |
||
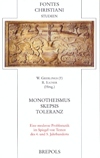 |
Monotheismus Skepsis Toleranz
Eine moderne Problematik im Spiegel von Texten des 4. und 5.
Jahrhunderts |
Die heutige Gesellschaft
ist aufgrund von kulturellem Austausch und Globalisierung mit einer
Vielzahl von Religionen konfrontiert. Das persönliche Bekenntnis spielt
eine immer größere Rolle. Die religiösen Traditionen verlieren an
Bedeutung. Im Klima der Indifferenzierung gewinnt die These der
Gleichwertigkeit der verschiedenen Religionen an Plausibilität.
Angesichts dieser Entwicklung gewinnt die Frage nach der Wahrheit der
Religion neu an Bedeutung.
|
||
Änderungen und Lieferbarkeit vorbehalten! |
|
| Abaelard: Ethik - Scito te ipsum - Erkenne dich selbst | hrsg. von Rainer Ilgner, 1 Bd. erscheint als Band 44 zur Beschreibung |
| Die Abgarlegende - Das Christusbild von Edessa / Doctrina Addai - De imagine Edessena | hrsg. von Martin Illert, 1 Bd. ,
erschienen als Band 45
zur Beschreibung |
| Alexander Monachus: Lobrede auf Barnabas - Laudatio Barnabae | hrsg. von Bernd Kollmann unter Mitarbeit von Werner Deuse, 1 Bd., Band 46 |
| Alexander Monachus: Auffindung des Kreuzes - Inventio crucis | |
| Ambrosius von Mailand:
Über den Glauben, an Gratian - De fide ad Gratianum |
hrsg. von Christoph Markschies, 3
Bde. erschienen als Band 47 zur Beschreibung |
| Ambrosius von Mailand: Über die Jungfrauen - De virginibus | hrsg. von Dückers, erschienen als Band 81 |
| Ambrosius von Mailand: Über Isaak oder die Seele - De Isaac vel anima | hrsg. von Ernst Dassmann, 1 Bd. erschienen als Band 48 |
| Anonymus von Cyzicus: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Günther Christian
Hansen, 2 Bde,
Band 49 zur Beschreibung |
| Apollinaris Sidonius: Gedichte - Carmina / Briefe - Epistulae | hrsg. von Ulrich Hamm, 3-4 Bde. |
| Arnobius der Jüngere: Streitgespräch mit Serapion - Conflictus cum Serapione | hrsg. von Klaus Daur, 2 Bde. |
| Athanasius von Alexandria: Gegen die Heiden - Contra Gentes | hrsg. von Frank-Joachim Simon, 2 Bde. siehe 978-3-458-70015-9 |
| Augustinus und Hieronymus: Briefwechsel - Epistulae mutuae | hrsg. von Alfons Fürst, 2 Bde., erschienen als Band 41 |
| Cäsarius von Heisterbach: Wundergeschichten - Dialogus miraculorum | übersetzt von Nikolaus Nösges, 4
Bde., Band 86
zur Beschreibung |
| Clemens von Alexandrien: Mahnrede - Protrepticus, Erzieher - Paedagogus, Teppiche - Stromata | hrsg. von R. Feulner, 4 - 6 Bde. |
| Cosmas der Indienfahrer: Christliche Topographie - Topographia Christiana | hrsg. von Horst Schneider, 3 Bde. |
| Didymus der Blinde: De spiritu sancto - Über den Heiligen Geist | übersetzt und eingeleitet von Hermann Josef Sieben, Band 78 |
| Ephraem der Syrer: Kommentar zum Diatessaron - Expositio Evangelii concordantis | hrsg. von Christian Lange, 2 Bd.
erscheint als Band 54
zur Beschreibung |
| Euseb von Cäsarea: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Hans Christof Brennecke
und Annette von Stockhausen, 3 - 4 Bde. siehe Reihe 5 |
| Evagrius Ponticus: Mönchsspiegel - Ad monachos, Nonnenspiegel - Ad virginem, Ermahnung an die Mönche - Institutio ad monachos | hrsg. von Chr. Joest, 1 Bd. erschienen als Band 51 |
| Evagrius Scholasticus: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Adelheid Hübner, 2 Bde. , erschienen als Band 57 |
| Guibert von Nogent: Autobiographie - De vita sua sive monodiarum libri tres | hrsg. von Reinhold Kaiser, 2 Bde. , erscheinen als Band 77/1 und 77/2 |
| Hieronymus: Briefe - Epistulae | hrsg. von Barbara Feichtinger, 8-10 Bde. |
| Hieronymus: Kommentar zu dem Propheten Jona - Commentarius in Ionam prophetam | hrsg. von Siegfried Risse, 1 Bd. erschienen als Band 60 |
| Hrabanus Maurus: Über die Unterweisung der Geistlichen - De institutione clericorum | hrsg. von Detlev Zimpel, 2 Bde. , erschienen als Band 61 |
| Jacobus de Voragine: Legenda Aurea | hrsg. von Bruno Häuptli, 8 Bde. |
| Johannes von Ephesus: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Peter Bruns, 2 Bde. |
| Johannes Philoponos: Über die Ewigkeit der Welt gegen Proklos - De aeternitate mundi contra Proclum | hrsg. von Clemens Scholten,
Band 64
zur Beschreibung |
| Laktanz: Die Todesarten der Verfolger - De mortibus persecutorum | hrsg. von Alfons Städele, 1 Bd. /
Band 43 zur Beschreibung |
| Monotheismus - Skepsis - Toleranz | hrsg. von W. Geerlings, R. Ilgner, /Erschienen als Studienband |
| Origenes: Homilien zur Genesis - Homiliae in Genesim / siehe auch Origenes Werke | hrsg. von Peter Habermehl, 1-2 Bde. |
| Pamphilus von Caesarea, Apologie für Origenes - Apologia Pro Origene | hrsg. von Georg Röwekamp / Erschienen als Band 80 |
| Philostorgios: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Friedhelm Winkelmann, 2 Bde. |
| Physiologus | hrsg. von Horst Schneider und Wilhelm Geerlings, 1 Bd. |
| Die Pseudoklementinen: Homilien - Homiliae | hrsg. von Jürgen Wehnert, 3 Bde. |
| Rufin von Aquileia: Kirchengeschichte, Buch 10-11 - Historia ecclesiastica, liber 10 - 11 | hrsg. von Martin Wallraff, 1 Bd. siehe Reihe 5 |
| Rupert von Deutz: Kommentar zum Hohenlied / Commentaria in Canticum Canticorum | hrsg. von Helmut und Ilse Deutz, 2 Bde. , erschienen als Band 70 |
| Sokrates von Konstantinopel: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Heinz-Günther
Nesselrath und Martin George, 2-3 Bde. siehe Reihe 5 |
| Sozomenos: Kirchengeschichte - Historia ecclesiastica | hrsg. von Günter Christian
Hansen, 4 Bde. erschienen als Band 73 zur Beschreibung |
| Sulpicius Severus / Venantius Fortunatus / Alkuin: Martinsschriften - De vita Martini | hrsg. von Sabine Harwardt, 2 Bde. |
| Tertullian: Gegen die Juden - Adversus Iudaeos | hrsg. von Regina Hauses, 1 Bd. |
| Tertullian: Über die Taufe - De baptismo / Vom Gebet - De oratione | hrsg. von Dietrich Schleyer, 1 Bd. erschienen als Band 76 |
| Tertullian: Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker - De praescriptione haereticorum | hrsg. von Dietrich Schleyer, 1 Bd. erschienen als Band 42 |
| Theodoret: Kirchengeschichte - Historia Ecclesiastica | hrsg. von Ulrich Hamm und Mischa Meier, 3 Bde. |