| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Calwer Theologische Monographien, Calwer Verlag | ||||||
| Reihe A, Bibelwissenschaft | ||||||
| A 10 | 3-7668-0583-5 | Georg Künzel | Studien zum Gemeindeverständnis des
Matthäus-Evangeliums. zur Beschreibung |
18,90 |
|
1978 |
| A 11 | 3-7668-0673-4 | Claus Westermann | Sprache und Struktur der Prophetie
Deuterojesajas. zur Beschreibung |
8,90 |
|
1981 |
| A 12 | 3-7668-0704-8 | Ferdinand Ahuis | Der klagende Gerichtsprophet. Studien
zur Klage in der Überlieferung von den alttestamentlichen
Gerichtspropheten zur Beschreibung |
14,80 |
|
1982 |
| A 13 | 978-3-7668-0699-4 | Ferdinand Ahuis | Autorität im Umbruch. Ein formgeschichtlicher
Beitrag zur Klärung der literarischen Schichtung und der
zeitgeschichtlichen Bezüge von Num 16 und 17 zur Beschreibung |
13,50 | 1983 | |
| A 14 | 3-7668-0735-8 | Claus Westermann | Vergleiche und Gleichnisse im Alten
und Neuen Testament. zur Beschreibung |
1984 | ||
| A 15 | 3-7668-0745-5 978-3-7668-0745-8 |
Martin Meiser | Paul Althaus als Neutestamentler.
Eine Untersuchung der Werke, Briefe, unveröffentlichten Manuskripte und
Randbemerkungen zur Beschreibung |
19,-- |
|
1993 |
| A 16 | 978-3-7668-3381-5 | Martin Schulz-Rauch | Hosea und Jeremia. Zur
Wirkungsgeschichte des Hoseabuches zum Vorwort |
19,-- |
|
1996 |
| A 17 | 978-3-7668-3426-3 | Nicholas Ho Fai Tai | Prophetie als Schriftauslegung in
Sacharja 9-14. Traditions- und kompositionsgeschichtliche Studien zur Beschreibung |
24,-- |
|
1996 |
| A 18 | 978-3-7668-3512-3 | Roland Gebauer | Paulus als Seelsorger. Ein exegetischer Beitrag
zur praktischen Theologie
zur Beschreibung |
29,00 | 1997 | |
| Reihe B, Systematische Theologie und Kirchengeschichte | ||||||
| B 2 | 3-7668-0453-7 | Ulrich Reetz | Das Sakramentale in der Theologie
Paul Tillichs zur Beschreibung |
9,90 |
|
1974 |
| B 5 | 3-7668-0630-0 | Justus Maurer | Prediger im Bauernkrieg
zur Beschreibung |
1979 | ||
| B 8 | 3-7668-0705-6 | Werner Schütz | Der christliche Gottesdienst bei
Origenes zur Beschreibung |
14,90 |
|
1984 |
| B 9 | 3-7668-0758-7 | Georg Kretschmar | Die Offenbarung des Johannes. Die Geschichte ihrer Auslegung im 1. Jahrtausend | 1985 | ||
| B 11 | 3-7668-0798-6 | Ralf Hoburg | Seligkeit und Heilsgewissheit.
Hermeneutik und Schriftauslegung bei Huldrych Zwingli bis 1522
zur Beschreibung |
14,90 |
|
1994 |
| B 12 | 978-3-7668-3344-0 | Wilfried Behr | Politischer Liberalismus und
kirchliches Christentum. Studien zum Zusammenhang von Theologie und
Politik bei Johann Christian Konrad von Hofmann (1810 - 1877)
zur Beschreibung |
|||
| B 13 | 3-7668-3449-5 | Paul Francis Matthew Zahl | Die Rechtfertigungslehre Ernst
Käsemanns zur Beschreibung |
15,00 |
|
1996 |
| B 14 | 3-7668-3466-5 978-3-7668-3466-9 |
Matthias Wünsche | Der Ausgang der urchristlichen
Prophetie in der frühkatholischen Kirche. Untersuchungen zu den
Apostolischen Vätern, den Apologeten, Irenäus von Lyon und dem
antimontanischtischen Anonymus zur Beschreibung |
19,-- |
|
|
| B 15 | 978-3-7668-3467-6 | Christian Peters | Apologia Confessionis Augustanae.
Untersuchungen zur Textgeschichte einer lutherischen Bekenntnisschrift
(1530-1584) zur Beschreibung |
29,-- |
|
1996 |
| B 16 | 978-3-7668-3546-8 | Ulrich Schindler-Jopppien | Das Neuluthertum und die Macht.
Ideologiekritische Analysen zur Entstehungsgeschichte des lutherischen
Konfessionalismus in Bayern
zur Beschreibung |
19,-- |
|
1998 |
| B 17 | 978-3-7668-3634-2 | Hans-Georg Tanneberger | Die Vorstellung der Täufer von der
Rechtfertigung des Menschen
zur Beschreibung |
19,-- |
|
1999 |
| Reihe C, Praktische Theologie und Missionswissenschaft | ||||||
| C 2 | 3-7668-0509-6 | Hans-Dieter Mattmüller | Verkündigung im Rundfunk.
Untersuchungen zur Sendung "Die Morgenfeier" zur Seite Rundfunkpredigten |
1976 | ||
| C 3 | 3-7668-0535-5 | Heinz Schmidt | Religionspädagogische
Rekonstruktionen. Wie Jugendliche glauben können zur Beschreibung |
6,80 |
|
1976 |
| C 4 | 3-7668-0559-2 | Gottfried Rothermundt | Buddhismus für die moderne Welt. Die
Religionsphilosophie K.N. Jayatillekes zur Beschreibung |
17,80 |
|
1979 |
| C 5 | 3-7668-0564-9 | Gerold Schwarz | Mission, Gemeinde und Ökumene in der
Theologie Karl Hartensteins
zur Beschreibung |
14,80 |
|
1980 |
| C 8 | 3-7668-0691-2 | Ernst Jaeschke | Gemeindeaufbau in Afrika. Die
Bedeutung Bruno Gutmanns für das afrikanische Christentum zur Beschreibung |
14,90 |
|
1981 |
| C 9 | 3-7668-0706-4 | Frieder Harz | Musik, Kind und Glaube. Zum Umgang mit Musik in der religiösen Erziehung | 1982 | ||
| C 11 | 3-7668-0718-8 | Walter Zwanzger | Christus für uns gestorben. Die
evangelische Passionspredigt zur Beschreibung |
1985 | ||
| C 12 | 978-3-7668-0752-6 | Ferdinand Ahuis | Der Kasualgottesdienst.. Zwischen Übergangsritus
und Amtshandlung zur Beschreibung |
6,40 | 1985 | |
| C 13 | 978-3-7668-0780-9 | Rudolf Landau | Die Nähe des Schöpfers. Untersuchungen zur
Predigt von der Vorsehung Gottes (zwischen 1890 -1945) zur Beschreibung |
19,-- | 1988 | |
| C 14 | 978-3-7668-0820-2 | Andreas Richter-Böhne | Unbekannte Schuld. Politische Predigt unter
allierter Besatzung. (Karfreitagspredigt Thielicke 1947 -
Landesbußtagspredigt Diem 1947) zur Beschreibung |
19,-- | 1989 | |
| C 15 | 978-3-7668-0871-4 | Wolfgang Bub | Evangelisationspredigt in der Volkskirche. Zu
Predigtlehre und Praxis einer umstrittenen Verkündigungsgattung zur Beschreibung |
19,-- | 1990 | |
| C 16 | 978-3-7668-3088-3 | Gerhard Schoenauer | Kirche lebt vor Ort. Wilhelm Löhes
Gemeindeprinzip als Widerspruch gegen kirchliche Großorganisation zur Beschreibung |
9,80 | 1990 | |
| C 17 | 3-7668-3106-2 | Stephan Peeck | Suizid und Seelsorge. Die Bedeutung
der anthropologischen Ansätze V.E. Frankls und P. Tillichs für Theorie
und Praxis der Seelsorge an suizidgefährdeten Menschen zur Beschreibung |
1991 | ||
| C 18 | 978-3-7668-3110-1 | Johannes Blohm | Die Dritte Weise. Zur
Zellenbildung in der Gemeinde. Betrachtungen und Überlegungen zur
Hauskreisarbeit unter Zugrundelegung einer empirischen Erhebung zur Beschreibung |
9,-- |
|
1992 |
| C 19 | 978-3-7668-3161-3 | Eugen Wölfle | Zwischen Auftrag und Erfüllung.
Eine pastoraltheologische Untersuchung und Begründung der
volkskirchlichen Bestattung zur Einleitung |
8,90 |
|
1993 |
| C 20 | 3-7668-3240-9 | Christian Eyselein | Segnet Gott, was Menschen schaffen? Kirchliche Einweihungshandlungen im Bereich des öffentlichen Lebens | vergriffen | 1993 | |
| C 22 | 978-3-7668-3287-0 | Hansjörg Biener | Christliche Rundfunksender weltweit.
Rundfunkarbeit im Klima der Konkurrenz
zur Beschreibung |
8,00 | 1994 | |
| C 23 | 978-3-7668-3318-1 | Hanns Kerner | Reform des Gottesdienstes.Von der
Neubildung der Gottesdienstordnung und Agende in der
evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern im 19. Jahrhundert bis zur
Erneuerten Agende zur Beschreibung |
9,80 |
|
1997 |
| 3-7668-3403-7 | Hanns Kerner | Die Reform des Gottesdienstes in Bayern im
19.Jahrhundert. Quellenedition. Band 3
Entwürfe der Gottesdienstordnung und der Agende 1852-1856, gebunden 600
Seiten zur Beschreibung |
25,00 |
|
1997 | |
| C 25 | 978-3-7668-3383-9 | Thorsten Moos | Konfirmandenarbeit und
missionarischer Gemeindeaufbau. zur Beschreibung |
9,80 |
|
1995 |
| C 26 | 3-7668-3468-1 | Helmut Thielicke | Konkretion in Predigt und Theologie | vergriffen | 1996 | |
| C 27 | 3-7668-3585-8 | Gerhard Knodt | Leitbilder des Glaubens. Die Geschichte des Heiligengedankens in der evangelischen Kirche | vergriffen | 1998 | |
| C 28 | 978-3-7668-3605-2 | Ingrid Schoberth | Glauben - lernen. Grundlegung einer
katechetischen Theologie zur Beschreibung |
19,-- | 1998 | |
| C 29 | 978-3-7668-3632-8 | Reiner Knieling | Predigtpraxis zwischen Credo und Erfahrung.
Homiletische Untersuchungen zu Oster-, Passsions- und
Weihnachtspredigten zur Beschreibung |
19,-- | 1999 | |
| C 30 | 3-7668-3692-7 | Christoph Morgner | Geistliche Leitung als theologische Aufgabe.
Kirche - Pietismus - Gemeinschaftsbewegung zur Beschreibung |
2000 | ||
 |
Georg
Künzel Studien zum Gemeindeverständnis des Matthäus-Evangeliums Calwer Verlag, 1978, 295 Seiten, Kartoniert 3-7668-0583-5 18,90 EUR |
"Du bist Petrus, und auf diesen
Felsen will ich meine Gemeinde bauen": Zentralstellen
neutestamentlicher Ekklesiologie finden sich mehrfach im
Matthäus-Evangelium, das
gerade darum auch als das "kirchliche Evangelium" gilt. Welches
Gemeindeverständnis tritt im Matthäus-Evangelium zutage? Die
redaktionsgeschichtlich orientierte Untersuchung will in drei
Schritten Selbstverständnis, Funktionen und Vollmacht der
Gemeinde klären helfen. Hinführend wird der Bereich der Christologie in die Überlegungen einbezogen. Darüber hinaus kommt die Geschichtsauffassung des Evangelisten ins Spiel. Anlaß dazu ist die Beobachtung, daß der Verfasser des MatthäusEvangeliums die Existenz der Kirche vor dem Hintergrund der Geschichte des alttestamentlichen Gottesvolkes reflektiert. So ergibt sich die These, daß die geschichtstheologische Auffassung des Evangelisten der Rahmen für Christologie und Ekklesiologie im ersten Evangelium ist. |
 |
Claus
Westermann Sprache und Struktur der Prophetie Deuterojesajas Mit einer Literaturübersicht "Hauptlinien der Deuterojesaja-Forschung von 1964-1979", zusammengestellt und kommentiert von Andreas Richter Calwer Verlag, 1981, 131 Seiten, kartoniert, 3-7668-0673-4 8,90 EUR |
Calwer
Theologische Monographien, Reihe A, Band 11 Ein Aspekt in der Wirkungsgeschichte der Kapitel 40-55 des Jesajabuches hat neben vielen anderen eine bis heute besondere Bedeutung. Er betrifft den Zusammenhang der Fragen: Wie kann in die Erfahrung einer großen geschichtlichen Katastrophe hinein einer großen Gruppe von Menschen gegenüber von Gericht und Erbarmen Gottes geredet werden? Oder anders: Gibt es menschliche und menschenwürdige Zukunft angesichts kollektiver Leidenserfahrung und Lebensbedrohung und wenn ja, wie ist sie vermittelbar? Claus Westermann geht in seiner Auslegung der dtjes Botschaft den Weg nach, der sich für Israel durch die Katastrophe hindurch zur Erwartung einer neuen Zukunft und der Erfahrung des Neubeginns erschließt. Dtjes meint die Zukunft, in der sich das Lob des Schöpfers und Herrn der Geschichte als Antwort des Menschen auf Gottes rettendes Handeln durchzusetzen beginnt. Dabei weisen die herausgearbeiteten Redeformen (Klage, Lob, Heilsorakel, Gerichtsreden, Bestreitungen usw.) auf das Geschehen hin, in welchem sich menschliche Wirklichkeit und Gottes Handeln in Gericht und Erbarmen begegnen. Der Botschaft Dtjes' liegt das Bekenntnis zugrunde, daß der Gott, dem Israel die Erfahrung der Rettung verdankt, nicht aufhören wird, sein Gott zu sein. So erfährt die Klage des einzelnen und die Klage des Volkes eine Antwort. Am Ende weitet sich der Blick in eine Zukunft, die durch die Treue Gottes zur Welt ermöglicht wird und von der Verheißung lebt, daß Gottes Wort bewirken wird, wozu er es sendet (Jes 55,11). |
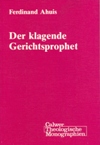 |
Ferdinand
Ahuis Der klagende Gerichtsprophet Calwer Verlag, 1982, 234 Seiten, kartoniert, 3-7668-0704-8 978-3-7668-0704-5 14,80 EUR |
Die vollständige
Neufassung der gleichnamigen Dissertation des Verfassers
berücksichtigt alle Klagen im Munde von Gerichtspropheten. Im
Mittelpunkt der Untersuchung stehen die Konfessionen Jeremias;
grundsätzlich gehört aber die Klage zum Wesen der
Gerichtsprophetie und ist daher bei allen Gerichtspropheten
vorauszusetzen. In den Konfessionen Jeremias lassen sich zwei
für die Gerichtsprophetie wesentliche formgeschichtliche Linien
feststellen: die Linie des Botenvorgangs , für den die Bedeutung
der Rückmeldung neu entdeckt wird, welche die Form einer Klage
annehmen kann; und die Linie des Wartens auf das Gericht, aus
dem sich unterschiedliche Formen der Klage erheben können. Beide
Linien lassen sich über die vorjeremianische Gerichtsprophetie
hinaus zurückverfolgen bis in die Überlieferung alltäglicher
zwischenmenschlicher Redevorgänge hinein: wo immer Menschen
beauftragt werden und wo immer Menschen warten, lassen sich auch
heute noch in der mündlichen Überlieferung analoge Formen der
Klage feststellen. Die Untersuchung richtet sich an alle, die
interessiert sind an dem Zusammenspiel zwischen der biblischen
Überlieferung und alltäglichen Vorgängen, an alle, die in den
Spannungsfeldern der Verkündigung stehen, und an alle, die mehr
wissen möchten über die Anfänge von theologischer Literatur im
Alten Testament.
Dr. theol. Ferdinand Ahuis, geb. 1942, ist Gemeindepfarrer in Hamburg-Kirchwerder. zur Seite Jeremia |
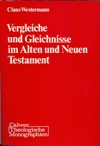 |
Claus
Westermann Vergleiche und Gleichnisse im Alten und Neuen Testament Calwer Verlag, 1984, 144 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0735-9 3-7668-0735-8 |
Calwer
Theologische Monographien, Reihe A, Band 14 "Bei den Untersuchungen der Gleichnisse Jesu fiel mir auf, daß den Auslegern eigentlich nur an der Deutung der Gleichnisse gelegen war. Es schien mir: sie ließen das Gleichnis sich nicht wirklich aussprechen; verwendbar war ihnen nur der gedankliche Extrakt aus ihnen. Man verstand das Gleichnis nur als Bild, nur als Illustration von Gedanken. Das brachte mich auf die Idee, einmal die Vergleiche im Alten Testament zu untersuchen. Ich fand, daß dort die Vergleiche fast nie der Veranschaulichung dienen, also nicht als Bilder gemeint sind, sondern ihre sehr verschiedene Funktion jeweils aus dem Zusammenhang erhalten, in dem sie begegnen. Und das sind meist dialogische Zusammenhänge; vor allem in den Psalmen und bei den Propheten. Hier haben sie eine keineswegs untergeordnete Bedeutung, sondern gehören notwendig zu dem, was die Prophetenworte und die Psalmen sagen wollen. Für das Verständnis der Gleichnisse Jesu folgt daraus, daß sie nicht mehr als Bildrede oder als Illustration von Gedanken verstanden werden können. Sie haben verschiedene Funktionen in den verschiedenen Zusammenhängen der Verkündigung Jesu, denen sie angehören. Da die Gleichnisse Erzählungen sind, können sie nicht in einer gedanklich-abstrakten Deutung festgelegt werden; sie können nur als Erzählung sprechen. Sie gehen nicht in einer Deutung auf, sondern sprechen nach den Deutungen, die man ihnen gegeben hat, als Erzählungen weiter." Inhaltsverzeichnis D. Claus Westermann, geb. 1909, ist Professor (em.) für Altes Testament an der Universität Heidelberg. |
 |
Martin
Meiser Paul Althaus als Neutestamentler Calwer Verlag, 1993, 455 Seiten, kartoniert, 3-7668-0745-5 978-3-7668-0745-8 19,00 EUR |
Eine Untersuchung der
Werke, Briefe, unveröffentlichten Manuskripte und
Randbemerkungen Inhaltsverzeichnis im pdf - Format weitere Literatur zu Paul Althaus |
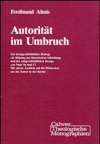 |
Ferdinand
Ahuis Autorität im Umbruch Ein formgeschichtlicher Beitrag zur Klärung der literarischen Schichtung und der zeitgeschichtlichen Bezüge von Num 16 und 17.Mit einem Ausblick auf die Diskussion um die Ämter der Kirche Calwer Verlag, 1983, 128 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0699-4 13,50 EUR |
In
Num 16 und 17 liegt der
literarische Niederschlag einer mehr als 500 Jahre
alttestamentlicher Sozialgeschichte umgreifenden Auseinandersetzung
um die Legitimation von Autorität vor uns. Dieser Uberlieferungskomplex beginnt neu zu sprechen in einer Zeit, da der Schock der antiautoritären Bewegung der ausgehenden 60er Jahre zunehmend der Erkenntnis weicht, daß die Auseinandersetzung um die Legitimation von Autorität etwas durchaus Normales, zum Leben in der Generationenfolge Hinzugehörendes ist. Jede Autorität erfährt aber auch ihre Legitimation und ihre Infragestellung durch Gott. Dies ist das Thema aller vier literarischen Schichten von Num 16 und 17 (Jahwist, Priesterschrift, deuteronomistische Redaktion des Tetrateuch, nachdeuteronomistische Erweiterungen) . Diese Auseinandersetzung vollzieht sich primär in der Form mündlicher Uberlieferung. Die von ihr erfaßten Vorgänge werden vor allem ermittelt mithilfe formgeschichtlicher Methode. So stellt diese aus der Gemeindepraxis erwachsene und in sie einmündende Untersuchung einen wesentlichen methodologischen Beitrag dar in einer Zeit, da alte Autoritäten auch in der Pentateuchforschung in Frage gestellt werden und neue erst ihre Legitimation finden müssen. |
 |
Martin
Schulz-Rauch Hosea und Jeremia Zur Wirkungsgeschichte des Hoseabuches Calwer Verlag, 1996, 260 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3381-5 19,00 EUR |
Das vorliegende Buch ist die
überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die im Sommer 1993
von der Evangelischen Theologischen Fakultät der
Ludwig-Maximilian-Universität in München angenommen wurde.
Bedingt durch meine Tätigkeit als Pfarrer in Indonesien und der
besonderen Situation theologischer Fachbibliotheken vor Ort war
es mir nicht mehr möglich, seither erschienene neuere Literatur
einzuarbeiten. Mein ganz besonderer Dank an dieser Stelle gilt meinem Lehrer, Professor Dr. Jörg Jeremias. Vom Anfang meines Studiums an hat seine faszinierende und lebendige Art der Lektüre des Alten Testaments mich begeistert und zu eigenem Nachdenken angeregt. Die Erstellung meiner Dissertation, für die er mir ein Thema überlassen hat, das seit langem schon der Neubearbeitung harrte, hat er mit großem Einfühlungsvermögen und vielen hilfreichen Anregungen behutsam gefördert. Besonders zu danken habe ich auch Professor Dr. Klaus Baltzer, der die Mühe des Korreferates auf sich genommen hat. Mein Dank gilt außerdem Herrn Professor Dr. Peter Stuhlmacher und Professor Dr. Jörg Jeremias für die Bereitschaft, meine Arbeit in der Reihe "Calwer Theologische Monographien" aufzunehmen. Ermöglicht wurde die Drucklegung durch einen Druckkostenzuschuß meiner Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wofür ich ebenfalls zu Dank verpflichtet bin. Besonders verbunden fühle ich mich schließlich allen Freunden und Kollegen, namentlich den anderen am Alttestamentlichen Institut promovierenden Mitdoktoranden für zahlreiche Diskussionen und manchen guten Rat. zur Seite Hosea / zur Seite Jeremia |
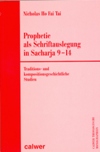 |
Nicholas
Ho Fai Tai Prophetie als Schriftauslegung in Sacharja 9-14 Traditions- und kompositionsgeschichtliche Studien Calwer Verlag, 1996, 309 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3426-3 24,00 EUR |
Das Hauptproblem in der Exegese
Deuterosacharjas (Sach 9-14)1 besteht darin, daß dieser wohl
jüngste prophetische Text des AT oftmals nur schwer zu verstehen
ist. Im Vergleich zur älteren Prophetie besteht die besondere
Schwierigkeit der Deutungen von DtSach darin, daß in diesem Text
manchmal Sätze ohne erkennbare Logik nebeneinander stehen.
Darüber hinaus werden Begriffe verwendet, die in sich leicht zu
verstehen sind, im Kontext aber erhebliche Schwierigkeiten
bereiten. Ein Beispiel fiir das erstgenannte Problem bietet
bereits der Anfang von DtSach in Sach 92. In V. 1-2 reiht DtSach
folgende Aussagen aneinander: Zuerst wird gesagt, daß »das
Jahwewort im Land Hadiach und in Damaskus seinen >Ruheplatz<
findet«. Dann kommt ganz unerwartet ein Satz »denn auf Jahwe
ist das Auge des Menschen (gerichtet) und alle Stämme Israels«.
Darauf folgt in V.2a wieder ein Satz über das syrische Gebiet
»und auch Hamat, das daran grenzt«. An Informationsgehalt bieten
die zwei Verse zunächst nur das Jahwewort in Verbindung mit
einigen Orten in Syrien. Mit einer solchen Satzfolge ist der
modeme Leser überfordert. Die Probleme mit der Begriftlichkeit Dtsachs lassen sich oft nur unter Rückgriff auf die traditionsgeschichtlichen Hintergründe bearbeiten. Ohne solche Rückgriffe dagegen sind die verwendeten Begriffe nicht recht verstehbar. zu Kommentaren Sacharja 9-14 |
 |
Roland
Gebauer Paulus als Seelsorger Ein exegetischer Beitrag zur praktischen Theologie Calwer Verlag 1997, 400 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3512-3 29,00 EUR |
Die vorliegende Studie schliesst
eine grosse Lücke in der Exegese wie in der Seelsorgelehre: Als
erste neutestamentliche Arbeit widmet sie sich dem Thema Seelsorge
aus exegetischer Sicht. Der 1.Teil zeigt, dass die Behandlung der Seelsorge als exegetisches Thema sachlich legitim ist, obwohl das, was man im Gefolge der neueren Seelsorgebewegung unter Seelsorge versteht und als solche praktiziert, im biblischen Schrifttum nicht oder nur am Rand begegnet. Der 2.Teil spürt Vollzüge von Seelsorge und ihre theologischen Grundlagen im Corpus Paulinum auf und beschreibt sie. Der 3.Teil befragt die gewonnene Skizze paulinischer Seelsorge auf ihre Bedeutung für die gegenwärtige Poimenik hin. Der Anhang stellt den Schriftgebrauch in zehn relevanten Seelsorgekonzeptionen seit dem 2.Weltkrieg dar und beurteilt ihn aus exegetischer Sicht. Ein wissenschaftliches Buch, von dem wichtige Impulse für die Praxis der Seelsorge "vor Ort" ausgehen. zur Seite Apostel Paulus |
 |
Ulrich
Reetz Das Sakramentale in der Theologie Paul Tillichs Calwer Verlag, 1974, 152 Seiten, kartoniert, 3-7668-0453-7 978-3-7668-0453-2 9,90 EUR |
Calwer
Theologische Monographien,Reihe B Band 2 Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch einen umfassenden Prozeß der Desakralisierung, dessen Auswirkungen wir heute noch garnicht voll ermessen können. Welche "Geisteslage" hat diese Entwicklung herbeigeführt, und wo liegen deren Wurzeln? Gibt es bereits Gegenkräfte, die sich gegen eine Desintegration unserer Lebensbereiche wenden mit dem Ziel, die Wirklichkeit als ganze wieder in den Blick zu bekommen? Diesen Fragen geht dieses Buch nach an Hand der Arbeit eines Theologen und großen Deuters der Geschichte, für den zeitlebens die entscheidende Frage gewesen ist: Wie verhält sich die Wirklichkeit von der die biblische Botschaft Zeugnis ablegt, zu der Wirklichkeit, in der wir leben? Können wir in der Bedingtheit unserer endlichen Wirklichkeit des Unbedingten gewahr werden? Wie verhalten sich Natur und Offenbarung zueinander, wie das Heilige und das Profane? Welche Rolle spielen die religiösen Symbole im Leben des Menschen? Es ergeben sich hier einige Gesichtspunkte, die zu einer neuen Besinnung über die geistige Situation unserer Zeit führen können. |
 |
Justus
Maurer Prediger im Bauernkrieg Calwer Verlag, 1979, 663 Seiten, Kartoniert, 3-7668-0630-0 |
Nicht erst wir denken über
Revolution, Repression und gewaltfreie Aktionen nach. Auch schon
aus den Jahren 1522 bis 1526 liegen uns viele Stellungnahmen zu
diesen Fragen vor. Am Bauernkrieg 1525 beteiligten sich viele
Anhänger der Reformation aktiv. Andere rechtfertigten das
Verhalten der Obrigkeit. Ein dritter Weg wurde versucht:
gewaltlose Forderungen, erhoben durch große Bauernlager. In Süddeutschland kann man eine Fülle von Verhaltensweisen und Schicksalen erkennen, die das Verhältnis von Reformation und Revolution, seither durch das Verhältnis Luther und Müntzer repräsentiert, von einer neuen Seite zeigen. Anhand der Gewaltfrage sucht die hier vorgelegte Arbeit dieses Verhältnis im einzelnen zu klären. Die einfache Entflechtung beider Bewegungen mit dem Verweis auf soziale Unterdrückung oder schwärmerische Mißverständnisse erweist sich als unmöglich. Der Verfasser versucht zunächst die Wirkung der Reformation in Süddeutschland für die Jahre bis 1525 zusammenzufassen und von da aus den Ausbruch des Bauernkriegs und das Verhalten einer Gruppe, der Geistlichen, zu verstehen. |
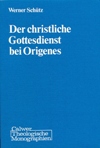 |
Werner
Schütz Der christliche Gottesdienst bei Origenes Calwer Verlag, 1984, 176 Seiten, kartoniert, 3-7668-0705-6 978-3-7668-0705-2 14,90 EUR |
Calwer
Theologische Monographien, Reihe B Systematische
Theologie Band 8 Diese Monographie bietet eine umfassende Untersuchung der Theologie des Gottesdienstes des Origenes wie auch seiner Predigtlehre- Dabei werden auch Themen wie biblischer Glaube und mystisches Erfahren, die Frage nach Pistis, Theoria, Gnosis und Praxis, die Fortgeschrittenen und Vollkommenen, die Erlösungslehre, das Opferverständnis des Gottesdienstes sowie die Eucharistieauffassung des Origines behandelt. Unter dieser Perspektive fällt in vielem ein neues Licht auf die moderne, widersprüchliche Origenesdiskussion. Als theologischer Lehrer der Kirche und als Prediger in der Kirche wird Origenes heute wieder neu entdeckt. |
 |
Ralf
Hoburg Seligkeit und Heilsgewissheit Hermeneutik und Schriftauslegung bei Huldrych Zwingli bis 1522 Calwer Verlag, 1994, 308 Seiten, kartoniert, 3-7668-0798-6 14,90 EUR |
In den letzten Jahrzehnten ist
vor allem durch die schweizer Reformationsforschung die
Auffassung vorherrschend geworden, Zwingli sei relativ
unabhängig von Luther über den Bibelhumanismus des Erasmus zum
Reformator geworden. Eine gewisse Unsicherheit der Forschung war
allerdings darin begründet, daß für die theologische Entwicklung
des jungen Zwingli weit weniger Quellen zur Verfügung stehen als
für Luther. In jüngster Zeit ist jedoch mehrfach darauf
hingewiesen worden, daß die Abhängigkeiten Zwinglis von Luther
wohl doch größer waren, als man bisher wahrhaben wollte. Zu diesem auch für die Deutung der gesamten beginnenden Reformation wesentlichen Problem leistet die vorliegende Untersuchung einen neuen Beitrag. Sie zieht dafür das bisher wenig erschlossene, weil schwer zu deutende Quellenmaterial der frühen Randbemerkungen Zwinglis in verschiedenen theologischen Werken, vor allem zu den Psalmen, heran. Die Randbemerkungen ermöglichen einen überraschenden Einblick in Zwinglis exegetische Arbeitsweise. |
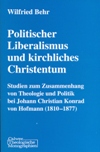 |
Wilfried
Behr Politischer Liberalismus und kirchliches Christentum Studien zum Zusammenhang von Theologie und Politik bei Johann Christian Konrad von Hofmann (1810 - 1877) Calwer Verlag, , 978-3-7668-3344-0 |
Diese Arbeit stellt sich die Aufgabe, dem Zusammenhang zwischen der Theologie Johann Christian Konrad von Hofmanns und seiner politischen Weltanschauung nachzugehen. Für eine solche Betrachtung muß Hofmann als eine besonders interessante Gestalt gelten, weil er nach Werk und Person die gewohnten Einordnungen der Theologiegeschichte in Frage stellt. Er gehörte zum Kreis der Erlanger lutherischen Theologie des 19. Jahrhunderts, die im kirchlichen Kontext zur konservativen Richtung gerechnet wird, und wirkte zugleich lange Zeit in führender Position in der liberalen Fortschrittspartei Bayerns. Da es Schwierigkeiten bereitete, Hofmanns liberal-politisches Engagement mit seiner Theologie in Verbindung zu bringen und dies schlecht zum Bild eines Lutheraners paßte, wurde der politische Aspekt seines Werkes bis auf vereinzelte Hinweise zumeist ausgeblendet. Unsere Untersuchung soll dagegen zeigen, daß im Denken Hofmanns, der kirchlich ein Konservativer und politisch ein Liberaler war, eine einheitliche Linie zu erkennen ist. Es soll deutlich werden, daß seine liberalpolitische Weltanschauung in unmittelbarem Zusammenhang mit den Grundentscheidungen seiner Theologie steht. Aufgrund dieses Ergebnisses gilt es dann, Hofmanns Einordnung in die Erlanger Theologie unter Betonung seiner Besonderheit zu bestimmen. |
 |
Paul Francis
Matthew
Zahl Die Rechtfertigungslehre Ernst Käsemanns Calwer Verlag, 1996, 224 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3449-2 3-7668-3449-5 15,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe B Band 13
Der Tübinger Neutestamentler Ernst Käsemann zählt zu den herausragenden Exegeten des 20. Jahrhunderts. Die vorliegende Arbeit untersucht das Verhältnis Käsemanns zu seinem Lebensthema: der Rechtfertigung des Gottlosen. ln der Rechtfertigung des Gottlosen sieht Käsemann das zentrale integrierende Motiv der paulinischen Kreuzestheologie, ja des gesamten Neuen Testaments. Diese Akzentsetzung durchzieht sein theologisches Werk bis heute. Die Originalität und schöpferische Unabhängigkeit seines Verständnisses der Rechtfertigungslehre unterscheidet diese von allen anderen theologischen Entwürfen zu diesem Thema. Käsemann bezieht fast alle systematischen und exegetischen Topoi auf das Rechtfertigungsgeschehen. In Käsemanns Interpretation und Akzentsetzung des paulinischen Anliegens sieht der Autor eine adäquate Form theologischen Redens und des Hoffens an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. |
 |
Matthias
Wünsche Der Ausgang der urchristlichen Prophetie in der frühkatholischen Kirche Untersuchungen zu den Apostolischen Vätern, den Apologeten, Irenäus von Lyon und dem antimontanischtischen Anonymus Calwer Verlag, 1996, 315 Seiten, Paperback, 3-7668-3466-5 978-3-7668-3466-9 19,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe B Band 14 In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, anhand des Phänomens der urchristlichen Prophetie dem Werden der Kirche auf die Spur zu kommen. Seit dem Neuprotestantismus herrscht immer noch in weiten Teilen der Forschung die Ansicht, der Frühkatholizismus sei das Ergebnis einer » Verfaliserscheinung« des lebendigen Urchristentums; nicht zuletzt die Beseitigung der Prophetie sei dafür verantwortlich Stellvertretend für viele Äußerungen mag der Satz des Basler Patristikers Franz Overbeck stehen, es sei den kirchlichen Gegnern des Montanismus darauf angekommen, »die christliche Prophetie totzuschlagen«. Ein-zelanalysen der im Urteil genannten Schriften des 2. Jahrhunderts gehen der Gestalt des Propheten und den Spuren dcs Prophetischen bis zur sog. »montanistischen Krise« an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert nach. Dabei kristallisiert sich zunehmend deutlicher heraus, daß die urchristliche Prophetie nicht eliminiert, sondern in verschiedene Bereiche des kirchlichen Lebens hinein transformiert wurde. Die gängige These, das kirchliche »Amt« hätte das »Charisma« verdrängt, erweist sich so als revisionsbedürftig. |
 |
Christian
Peters Apologia Confessionis Augustanae Untersuchungen zur Textgeschichte einer lutherischen Bekenntnisschrift (1530-1584) Calwer Verlag, 1996, 664 Seiten, kartoniert 3-7668-3467-3 978-3-7668-3467-6 29,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe B Band 15 Melanchthons Apologie des Augsburger Bekenntnisses von 1530 ist in ihrer theologischen Bedeutung allgemein anerkannt. Gleichzeitig gilt sie aber auch vielen als ein Dokument heute eher irritierender theologischer Orthodoxie. In der ökumenisch orientierten Diskussion um den Augsburger Reichstag von 1530 ist sie bezeichnenderweise fast völlig außer Betracht geblieben. Es ist heute kaum mehr bekannt, wie bewegt die Entwicklung gewesen ist, die der Text der Apologie von seinen ältesten, noch in Augsburg entstandenen Fassungen bis hin zu den maßgeblichen Drucktexten der Jahre 1531/1533 durchlaufen hat. Das Buch behandelt die wichtigsten der in diesem Zusammenhang neu auftauchenden Fragen, z.B. das Verhältnis zu den Augsburger Ausschußverhandlungen; Luther und die Apologie; Rezeption der gedruckten Apologie bis hin zum Konkordienbuch. Ein Anhang bietet drei wichtige Editionen des Textes; »Das dem Kaiser am 22.9.1530 angetragene Exemplar der lateinischen Apologie«, »Die älteste Textgestalt der deutschen Apologie« und »Die frühe >Wittenberger Redaktion< der deutschen Apologie«. zur Seite Augsburger Bekenntnis
|
 |
Ulrich
Schindler-Joppien Das Neuluthertum und die Macht Calwer Verlag 1998, 360 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3546-8 19,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe B Band 16 Ideologiekritische Analysen zur Entstehungsgeschichte des lutherischen Konfessionalismus in Bayern Das Neuluthertum des 19.Jahrhunderts stand in einer Wechselbeziehung zu den wichtigen politischen Machtträgern: Staatliche Macht gab bei kirchlichen Entscheidungen oft den Ausschlag; im Gegenzug legitimierte die neulutherische Zweireichelehre bestehende Machtverhältnisse. -- Die Arbeit beschäftigt sich exemplarisch mit der Entstehungs- geschichte des lutherischen Konfessionalismus in Bayern. Jene Wechselbeziehung zur politischen Macht wird erstmals umfassend und in ihren verschiedenen Zusammenhängen analysiert. -- Wichtigste Quelle der Arbeit ist die Zeitschrift "Homiletisch-liturgisches Correspondenzblatt" (1825-1838), das sehr schnell zu einem Sammelbecken von Erweckungstheologen aus ganz Deutschland wurde. Im Anhang des Buches findet sich ein Register der Autoren und Beiträge dieser Zeitschrift. Die Arbeit nimmt neben kirchenhistorischen und systematisch-theologischen Diskursen auch die publizistikgeschichtliche Forschung auf. Darüber hinaus bietet sie ein eigenständiges, philosophisch und theologisch begründetes Konzept kirchlicher Geschichtsschreibung.
|
 |
Hans-Georg
Tanneberger Die Vorstellung der Täufer von der Rechtfertigung des Menschen Calwer Verlag, 1999, 272 Seiten, 978-3-7668-3634-2 19,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe B Band 17 Die Reformation des 16. Jahrhunderts hat nicht nur die Spaltung der einen abendländischen Kirche in zwei große Konfessionen bewirkt, sondern hat auch am Rande geistige Strömungen hervorgebracht, die sich weder der römisch-katholischen noch der evangelischen Kirche zuordnen lassen. Kriterium für die Trennung der abendländischen Kirche in verschiedene Konfessionen war einst wie heute das Dogma der Rechtfertigung. Diese Studie fragt ausgehend von der gemeinreformatorischen Rechtfertigungslehre nach dem bisher wissenschaftlich nicht hinreichend geklärten Verhältnis der Täufer des 16. Jahrhunderts zu diesem Dogma, indem er die Theologien verschiedener Vertreter dieser Richtung (wie z.B. Konrad Grebel, Balthasar Hubmaier, Hans Hut u.a.) zu Wort kommen läßt und sie interpretiert. |
 |
Heinz
Schmidt Religionspädagogische Rekonstruktionen Wie Jugendliche glauben können Calwer Verlag, 1976, 228 Seiten, 320 g, kartoniert, 3-7668-0535-5 978-3-7668-0535-5 6,80 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Band 3 Zu diesem Buch Rekonstruieren heißt neu zusammenfügen, was einst ein Ganzes war, jetzt aber verstreut ist. Wer etwas rekonstruiert, wird dabei bestimmten Menschen und ihren Sehgewohnheiten Rechnung tragen müssen. Religionspädagogik muß heute die Inhalte des christlichen Glaubens aus zum Teil sachfremden Kontexten lösen und neu verbinden. Sie kann das nur mit Erfolg tun, wenn sie sich um eine Gestalt christlichen Glaubens bemüht, die Kinder und Heranwachsende unserer Zeit auf dem Hintergrund ihrer Kenntnisse und Erfahrungen nachvollziehen können. Sie muß demnach zur Theologie der Kinder und Heranwachsenden werden. Den Weg zu solch einer ""elementaren Theologie"" will dieses Buch abstecken. Ohne eine gründliche Auseinandersetzung mit der neueren religionspädagogischen Entwicklung (seit 1945) kann es dabei nicht abgehen. Denn diese ist ein Lehrstück für die Verzerrungen und Verkürzungen, denen einseitig pointierte theologische Entwürfe ausgesetzt sind, wenn sie wenig reflektiert in der Praxis ankommen. Die gegenwärtige Lage ist vollends zerfasert. Unkritische Bibelrenaissance auf der einen Seite, ideologie-kritische, emanzipatorische oder therapeutische Konzepte auf der anderen wollen zu neuen religionspädagogischen Heilslehren entarten. Wiederum verabsolutiert man einzelne Aspekte der christlichen Überlieferung oder des neuzeitlichen Denkens. Die Lebenswelt der Jugendlichen und die christliche Überlieferung sind aber schon je für sich äußerst vielschichtig und komplex. Beide differenziert zu sehen und überschaubar zu gliedern ist nur der erste Schritt der hier geleisteten Rekonstruktionsarbeit. Es gelingt darüber hinaus, sie aufeinander zu beziehen und dabei Inhalte des christlichen Glaubens zu beschreiben, die erneuernd wirken können. Daß so Theologie ihre kritische Kraft gegenüber anscheinend selbstverständlichen Überzeugungen und Verhaltensweisen wieder zu entfalten beginnt, wird zumindest den nicht wundern, der sich mit der theologischen Wende der Zwanzigerjahre befaßt hat. Ein Glaube, der nur bestätigt, was auch sonst immer schon betrieben wird, ist überflüssig. Glaube und Lebenswelt Heranwachsender sind zwar zusammen, jedoch in dialektischer Spannung zu rekonstruieren, damit Theologie ohne Selbstaufgabe elementar werden kann. Inhaltsverzeichnis Dr. Heinz Schmidt, geboren 1943, ist Dozent am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. |
 |
Gottfried
Rothermundt Buddhismus für die moderne Welt Die Religionsphilosophie K.N. Jayatillekes Calwer Verlag, 1979, 190 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0559-1 3-7668-0559-2 17,80 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Band 4 In unserem Jahrhundert erwartete man im Westen den sicheren Verfall des Buddhismus. Umso überraschender ereignet sich seit 20 oder 30 Jahren "Buddhas Wiederkehr"! Es gibt eine buddhistische "ökumenische" Bewegung, es gibt missionarische Aktivität und das Eindringen buddhistischen Gedankenguts im "christlichen Abendland". Als Christen müsserl wir uns diesem Buddhismus in erneuerter Gestalt stellen. Kalatissa Nanda Jayatilleke, Angehöriger eines schon in vorchristlicher Zeit aus Indien kommenden und in Sri Lanka (= Ceylon) eingewanderten buddhistischen Volkes, repräsentiert in seiner Weise diese erneuerte Religion. Er studierte 1939 bis 1943 am University College of Ceylon, 1946 bis 1949 abendländische Philosophie in Cambridge. Als Universitätsprofessor tritt er weltweit in zahlreichen Vorlesungen (meist in englischer Sprache) für seinen Glauben ein. Das vorliegende Buch stellt die Hauptanliegen des Werkes von Jayatilleke deutlich ins Licht, so zum Beispiel die für ihn zentrale Lehre von der Wiedergeburt. Damit gibt es nicht nur eine Darstellung des modernen Buddhismus, sondern stellt einen gewichtigen "Gesprächspartner" für den unumgänglichen Dialog des .Christentums mit einer der großen Weltreligionen vor. |
 |
Gerold
Schwarz Mission, Gemeinde und Ökumene in der Theologie Karl Hartensteins Calwer Verlag, 1980, ca 350 Seiten, 1 Bildtafel, kartoniert, 978-3-7668-0564-5 3-7668-0564-9 14,80 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Band 5 Karl Hartenstein (1894-1952) hat - als Direktor der Basler Mission (1926-1939) und später als Prälat in Stuttgart - eine ganze Epoche der deutschen Missionswissenschaft geprägt. Die hier vorgelegte Arbeit ist der bislang einzige Versuch einer Gesamtdarstellung von Hartensteins theologischem Denken. Sein weit gespanntes theologisches Bemühen, das immer wieder um die beiden Brennpunkte Mission und Gemeinde im Horizont der Ökumene kreiste, wird in den entscheidenden Grundlinien nachgezeichnet. Zugleich ist dieses Buch ein wichtiger Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion um das Wesen und den Auftrag von Mission und Ökumene: es bringt eine im theologischen Gespräch der Gegenwart allzulang vergessene Stimme wieder zu Gehör. Dem Verfasser war es wichtig, Hartenstein selbst in größeren Textzusammenhängen zu Wort kommen zu lassen, um den Verkündigungscharakter seiner Theologie, den »authentischen« Karl Hartenstein deutlich hervortreten zu lassen. Der Leser erhält durch diese flüssig und interessant geschriebene Arbeit Einblick in das theologische Werk eines Mannes, der in erster Linie Prediger des Evangeliums sein und der Verkündigung in der umfassenden apostolischen Weite missionarischen Denkens und Handeins dienen wollte. Gerold W. Schwarz, geboren 1941. Studium der Theologie, Altphilologie und Neuphilologie in Tübingen (Evang. Stift), Berlin und Edinburgh. Referendardienst in Tübingen. Anschließend Repetent am Ev. theol. Seminar in Urach. Zur Zeit im Schuldienst in Esslingen. |
 |
Ernst
Jaeschke Gemeindeaufbau in Afrika Die Bedeutung Bruno Gutmanns für das afrikanische Christentum Calwer Verlag, 1981, 350 Seiten, 510 g, Kartoniert, 3-7668-0691-2 978-3-7668-0691-8 14,90 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Praktische Theologie und
Missionswissenschaft Band 8 Zu diesem Buch Dr. Bruno Gutmann (1876 - 1966) war wohl der bedeutendste deutsche Missionar in Ostafrika. In 30jährigem Missionsdienst hat er die Bantu-Kulturen und die Seele der Wadschagga am Kilimandscharo bis in ihre Tiefen ausgelotet. Mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen erwarb er sich hohe Anerkennung, aber auch Kritik von seiten der dialektischen Theologie, die - von ihrem (europäischen) Standpunkt her - seinen theologischen Ansatz nicht verstehen konnte. Er selbst ist seinen Weg unbeirrt gegangen; weit mehr, als er voraussehen konnte, hat die Entwicklung der Kirchen in der Dritten Welt seinen Einsichten recht gegeben. Heute ist es uns schmerzlich deutlich geworden, was westliche Kultureinfliisse zerstört haben; wir entdecken zugleich, daß wir selber die Grundwerte alter Kulturen neu buchstabieren lernen miissen, wenn wir uns nicht im Abgrund menschlicher Beziehungslosigkeit verlieren wollen. Ernst Jaeschke, geb. 1911, wurde 1938 Gutmanns Nachfolger in Alt-Moschi. Er war dann Pfarrer in Nürnberg, Missionar in Neuguinea, Exekutiv-Sekretär der Leipziger Mission fiir Westdeutschland. |
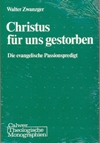 |
Walter
Zwanzger Christus für uns gestorben Die evangelische Passionspredigt Calwer Verlag, 1985, 296 Seiten, kartoniert, 3-7668-0718-8 |
Calwer
Theologische Monographien, Band C Band 11 Die Passionspredigt gehört zu den schwierigsten homiletischen Aufgaben in der Gegenwart. Wie kann vom Sinn des Leidens und Sterbens Jesu so geredet werden, daß dadurch bei der hörenden Gemeinde Wege zu einem glaubenden Verstehen geöffnet werden? Dieser zentralen Frage der kirchlichen Verkündigung muß sich die gegenwärtige Homiletik stellen. Die Arbeit will zur Klärung dadurch beitragen, daß sie nach der konkreten Predigtpraxis in der. Vergangenheit zurückfragt. Dabei beschränkt sie sich auf den für die Verkündigung der Gegenwart bedeutungsvollen Zeitraum des 19. Jahrhunderts. Im historischen Hauptteil wird das umfangreiche Quellenmaterial sorgfältig nach systematischen, homiletischen und hermeneutischen Gesichtspunkten analysiert. Es werden neun Typen der Passionsverkündigung herausgearbeitet, die sich in ihrer homiletisch-kerygmatischen Intention charakteristisch voneinander unterscheiden. Ein Methodenkapitel und die Darstellung der homiletischen Anleitung zur Passionspredigt im 19. Jahrhundert leiten die Arbeit ein. In einem ausführlichen Schlußteil erfolgt eine kritische Wertung der Predigten im Blick auf die aktuelle homiletische Problematik. Hier wird nicht nur das Gespräch mit der gegenwärtigen Homiletik aufgenommen, sondern auch die heutige Diskussion der theologischen Grundfragen der Passionsverkündigung in die Erörterung einbezogen. |
 |
Ferdinand Ahuis Der Kasualgottesdienst. Zwischen Übergangsritus und Amtshandlung. Calwer Verlag, 1985, 200 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0752-6 6,40 EUR |
So weit sich die
Menschheitsgeschichte überblicken läßt, sind an den vier
wichtigsten Wendepunkten im menschlichen Lebensbogen Riten
vollzogen worden: im Zusammenhang mit der Geburt, der Pubertät,
der Eheschließung und dem Tod. Diese von der Religionsethnologie
als Übergangsriten (rites de passage) bezeichneten Begehungen
werden von der Praktischen Theologie in verstärktem Maße als
Modelle für die Interpretation der entsprechenden kirchlichen
Riten (Kindtaufe. Konfirmation, Trauung, Beerdigung)
herangezogen, seitdem die Meinungsumfragen der 70er Jahre ihre
Bedeutung für die Zugehörigkeit des Menschen zur Kirche ergeben
haben. Gleichwohl ist die Frage der theologischen Begründung für
die Beteiligung des Pfarrers bzw. der Pfarrerin an diesen
Begehungen noch kaum beantwortet. Dies ist um so erstaunlicher,
als diese Riten einen erheblichen Teil der pfarramtlichen
Tätigkeit ausmachen. Als Amtshandlungen sind sie verkürzt aus
dem Blickwinkel des pfarramtlichen Auftrags, speziell des
Verkündigungsauftrags, verhandelt worden. Demgegenüber versucht
dieses Buch, die Aussage über die Schöpfung des Menschen durch
Gott neu ins Blickfeld zu rücken. Die Aussagen über die
Menschenschöpfung finden sich häufig in gottesdienstlichen
Texten, die auf das Umfeld der Familie bezogen sind. Auf diesem
Wege wird es möglich, die in der Theoriebildung häufig
vernachlässigte, in der Praxis aber nicht wegzudenkende
gottesdienstliche Dimension der Übergangsriten / Amtshandlungen
neu zu bedenken. Religionsethnologische Phänomene finden in diesem Buch ebenso Berücksichtigung wie Vorgänge und Texte aus der kirchlichen Praxis. Für die Vermittlung zwischen dem tatsächlichen Vollzug der Kasualgottesdienste und ihrer wissenschaftlichen Durchdringung spielt ihre bislang kaum genügend erforschte Verarbeitung in den Büchern des Alten Testaments eine tragende Rolle. zur Seite Kasualgottesdienste |
 |
Rudolf
Landau Die Nähe des Schöpfers Untersuchungen zur Predigt von der Vorsehung Gottes (zwischen 1890 - 1945) Calwer Verlag, 1988, 208 Seiten, Kartoniert, 3-7668-0780-3 978-3-7668-0780-9 19,00 EUR |
Calwer Theologische Monographien -
Reihe C - Band 13 Der Autor untersucht an einigen konkreten Beispielen die Predigt von der Vorsehung vornehmlich zwischen 1890 und 1945. Mit der Analyse dieses bestimmten Abschnitts der Predigtgeschichte soll deutlich werden, auf welche Weise heute vom Welthandeln Gottes in der christlichen Gemeinde geredet werden kann und muss. Predigten von F.Loofs, Chr. Blumhardt (d.J.) , H.J. Iwand und K.H. Miskotte sind Grundlagen der Untersuchung. |
 |
Andreas
Richter-Böhne Unbekannte Schuld Calwer Verlag, 1989, 220 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0820-2 19,00 EUR |
Politische Predigt unter allierter
Besatzung. (Karfreitagspredigt Thielicke 1947 - Landesbußtagspredigt
Diem 1947) »Adam schiebt die Schuld auf Eva, Eva auf die Schlange; das Verschieben von Schuld gehört offenbar zum Menschen, der sich schuldig macht. Darum muß Schuld benannt, ins Bewußtsein gehoben, zurechtgerückt, gepredigt werden. Auch die >unbekannte Schuld< der Vergangenheit ist kein Schnee von gestern. Sie schmilzt nicht durch Vergessen und bedroht uns, wo wir sie ins Vergessen abschieben.« (Rudolf Bohren) |
 |
Wolfgang
Bub Evangelisationspredigt in der Volkskirche Zu Predigtlehre und Praxis einer umstrittenen Verkündigungsgattung Calwer Verlag, 1990, 335 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-0871-4 19,00 EUR |
Der Verfasser klärt die
Evangelisationspredigt als Gegenstand der Praktischen Theologie und
zeigt ihre historischen Zugänge. Er analysiert 180 Predigten
zeitgenössischer Evangelisten. Dabei fragt er nach dem Verhältnis
von Prediger, Schrift und Hörer, untersucht zentrale theologische
Inhalte wie Dreieiniger Gott, Heilsaneignung, Ekklesiologie,
Eschatologie und setzt sich kritisch mit den rhetorischen Mitteln
dieser Verkündigungsgattung auseinander. Eine Homiletik der Evangelisationspredigt steht seit langem aus. Vorurteile und BefÜhrungsängste müssen abgebaut werden, soll es zu einem fruchtbaren Austausch zwischen Gemeinde- und Evangelisationspredigt kommen. |
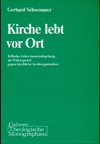 |
Gerhard
Schoenauer Kirche lebt vor Ort Wilhelm Löhes Gemeindeprinzip als Widerspruch gegen kirchliche Großorganisation Calwer Verlag, 1990, ca 208 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3088-3 9,80 EUR |
In der gegenwärtigen Diskussion um
den Gemeindeaufbau geschieht es häufig, daß ausgehend vom Befund der
Volkskirche, praktische Konzepte und Handlungsanweisungen entwickelt
werden. Die theologische Rechtfertigung dieser Konzepte wird dann
nachgeschoben. Eine intensive Beschäftigung mit dem Gemeindeprinzip Wilhelm Löhes kann der Gefahr entgegenwirken. das theologische Urteil den Konzepten des Gemeindeaufbaus einfach anzupassen. Löhes erste Frage war zeitlebens: was denn die Kirche sei und wo sie ist. Die Kirche vor Ort. die Einzelgemeinde und dadurch auch das Laienelement sind die Ausgangspunkte bei dem Streit um die Kirchenverfassung. Dadurch wird eine wesentliche Korrektur an den sogenannten »volkskirchlichen Konzepten« möglich, sind sie alle doch in erster Linie an städtischen Situationen ausgerichtet und zielen auf überregionale Strukturen. Gerhard Schoenauer, geb. 1954, Dr. theol., studierte in Neuendettelsau und Erlangen. Er war Studieninspektor im Werner-Elert-Heim in Erlangen und Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Kirchenrecht, Erlangen. Jetzt arbeitet er als Gemeindepfarrer in Eysölden. |
 |
Stephan
Peeck Suizid und Seelsorge Die Bedeutung der anthropologischen Ansätze V.E. Frankls und P. Tillichs für Theorie und Praxis der Seelsorge an suizidgefährdeten Menschen Calwer Verlag, 1991, 307 Seiten, kartoniert, 3-7668-3106-2 vergriffen, nicht mehr lieferbar |
Calwer
Theologische Monographien, Calwer Verlag Band 17 Die Statistik der Bundesrepublik und der Industrieländer zeigt ein deutliches Steigen der Selbstmordziffern an. Auf dem Hintergrund dieser Situation will das vorliegende Buch einen Beitrag zur Suizidverhütung leisten. Besonderen Wert legt der Autor dabei auf die Übersetzung der ausführlich dargelegten theoretischen Überlegungen zur Suizidalität und deren Verhütung in die Praxis der Seelsorge und der therapeutisch-beraterischen Arbeit mit den gefäihrdeten Menschen. Inspiriert von dem existenzanalytisch-Iogotherapeutischen Ansatz V. E. Frankls, setzt sich Stephan Peeck in einem humanwissenschaftlichen Teil kritisch mit wesentlichen Ergebnissen bisheriger Suizidforschung auseinander. Er gelangt auf diesem Wege zu einem integrierten Verständnis von Suizidalität. In einem zweiten Teil zeigt der Autor in kritischer Auseinandersetzung mit dem Gedankengut Frankls die Relevanz des existenzanalytischlogotherapeutischen Beratungsansatzes für die kirchliche Seelsorge (an suizidgefahrdeten Menschen) auf. Beide Theorieteile münden in einen praxisorientierten Teil ein. Hier gibt Stephan Peeck an hand von ausgewählten Gesprächsfragmenten und einer systematischen Zusammenfassung wesentlicher, praxisbezogener Gesichtspunkte einen dezidierten Einblick in die konkrete, beratende bzw. seelsorgerliche Arbeit mit suizidgefahrdeten Menschen. Stephan Peeck. geb. 1955, studierte in Bethel, Tübingen und Hamburg. Er promovierte mit vorliegender Arbeit bei Manfred Seitz zum Dr. theol. und absolvierte eine dreijährige Ausbildung am Hamburger Institut für Existenzanalyse und Logotherapie. Seit 1990 arbeitet er als Existenzanalytiker in eigener logotherapeutischer Beratungspraxis. |
 |
Johannes
Blohm Die Dritte Weise Zur Zellenbildung in der Gemeinde. Betrachtungen und Überlegungen zur Hauskreisarbeit unter Zugrundelegung einer empirischen Erhebung Calwer Verlag, 1992, 250 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3110-1 9,00 EUR |
Die Studie widmet sich den
biblischen, historischen und praktisch-theologischen Aspekten der
von Luther als »Dritte Weise« bezeichneten Form des Gottesdienstes,
der die heutige Hauskreisarbeit nahekommt. Der erste Teil verfolgt die Wurzeln der Hauskreisarbeit im NT und beschreibt die im Anschluß an Luther entstandenen theoretischen Entwürfe bis zu den neu esten Gemeindeaufbauprogrammen. Im zweiten Teil wird eine bisher einzigartige empirische Erhebung unter zahlreichen Hauskreisen vorgestellt, die ein detailliertes Bild entstehen läßt und eine fundierte Bewertung der Hauskreisarbeit ermöglicht. Johannes Blohm, geb. 1956, studierte Evang. Theologie in Erlangen und Neuendettelsau. Er promovierte mit vorliegender Arbeit bei Manfred Seitz zum Dr: theol. Nach Vikariat und mehljährigem Dienst als Gemeindepfarrer leitet er seit 1991 die Kinderkirche im Amt für Gemeindedienst in der evang.-Iuth. Kirche in Bayern. |
 |
Eugen
Wölfle Zwischen Auftrag und Erfüllung Calwer Verlag, 1993, 183 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3161-3 8,90 EUR |
Eine pastoraltheologische
Untersuchung und Begründung der volkskirchlichen Bestattung Die Kirche als Volkskirche bestattet durch ihre Pfarrer auf Wunsch von Angehörigen oder Bekannten Verstorbene, die durch die Taufe als »Initiationsakt am Anfang des Christenstandes« Glieder der christlichen Gemeinde wurden und waren. Mit dieser Aussage ist im wesentlichen das Problemfeld der volkskirchlichen Bestattung angerissen. zur Seite Kasualgottesdienste Bestattung |
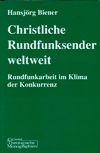 |
Hansjörg Biener Christliche Rundfunksender weltweit Rundfunkarbeit im Klima der Konkurrenz Calwer Verlag, 1994, 329 Seiten, kartoniert, 3-7668-3287-5 978-3-7668-3287-0 8,00 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Band 22 Die Darstellungen zur Rundfunkgeschichte haben bisher nur im Vorübergehen von der Merkwürdigkeit Notiz genommen, daß sich Christentum und Rundfunk immer wieder getroffen haben. Das gilt nicht nur dafür, daß die Technik im christlichen Kulturkreis entwickelt worden ist, sondern auch für die ausgestrahlten Inhalte. Die »World Christian Encyclopedia« hingegen konstatiert: »Auf viele Weisen haben christlicher Rundfunk und christliches Fernsehen eine bedeutende Wirkung auf das heutige Wachstum der Kirchen.«l |
 |
Hanns
Kerner Reform des Gottesdienstes Von der Neubildung der Gottesdienstordnung und Agende in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern im 19. Jahrhundert bis zur Erneuerten Agende Calwer Verlag, 1997, 286 Seiten, broschur, 978-3-7668-3318-1 9,80 EUR |
Calwer
Theologische Monographien Reihe C Band 23 Seit Anfang 1991 ist der Entwurf der Erneuerten Agende in der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern in Erprobung. Bis Ende 1995 soll dieser Prozeß abgeschlossen sein. Da zugleich eine Entscheidung über die Gottesdienstordnungen für den bayerischen Regionalteil des neuen Gesangbuchs fallen mußte, verzahnten sich erste Ergebnisse des Erprobungsprozesses mit grundsätzlichen Erwägungen. Die Erneuerte Agende mußte also schneller als vorgesehen und gleichzeitig mit der Erprobung in den Gemeinden auf Herz und Nieren überprüft werden. Dabei wurden neben liturgischen und kommunikationstheoretischen Fragestellungen auch historische Klärungen nötig. Innerhalb des Entscheidungsprozesses, welche Gottesdienstordnungen in welcher Form Aufnahme in das neue Gesangbuch finden sollten, spielt die »alte bayerische« Agende eine bedeutsame Rolle. In einem nicht unerheblichen Teil der bayerischen Gemeinden ist sie immer noch die geltende und regelmäßig praktizierte Gottesdienstordnung. Diese in der derzeitigen VELKD-Agende, Ausgabe Bayern, als "Gottesdienstordnung von 1854" bezeichnete Liturgie gab gerade hinsichtlich der Erneuerten Agende zu grundsätzlichen Überlegungen Anlaß, nicht nur weil sie in wichtigen Teilen leicht modifiziert dort wiederzufinden war. zur Seite Agenden |
 |
Hanns Kerner Die Reform des Gottesdienstes in Bayern im 19.Jahrhundert Quellenedition. Band 3 Entwürfe der Gottesdienstordnung und der Agende 1852-1856 Calwer Verlag, 1997, 590 Seiten, 1150 g, gebunden, 3-7668-3403-7 978-3-7668-3403-4 25,00 EUR |
Vorwort Mit den hier vorgelegten Entwürfen von Agenden und Gottesdienstordnungen von 1852-1856 werden wegweisende Stationen in der bayerischen Agendenentwicklung markiert. Der 1852 zur Erprobung in den Gemeinden freigegebene Agendenentwurf fand an vielen Orten lange Zeit Verwendung. In einen offiziellen Status gelangte er allerdings nicht, da in ihm noch Reste von liturgischem Gut aus liberalen und rationalistischen Agenden enthalten waren. Den bedeutendsten Punkt in der Agendenentwicklung der protestantischen Gesamtgemeinde in Bayem im 19. Jahrhundert stellt der Entwurf der Gottesdienstordnung von 1853 dar. Johann Wilhelm Friedrich Höfling hatte sie mit dem Ziel entworfen, konfessionelle lutherische Lehre mit dem Gottesdienstleben in Übereinstimmung zu bringen. Daher war ein Bruch rnit der bisherigen Entwicklung der Ordnung des Hauptgottesdienstes nicht zu vermeiden. Nachdem 1854 noch verschiedene Veränderungen an der Gottesdienstordnung vorgenommen worden waren, wurde sie -immerhin nach einem Prozeß von mehr als dreißig Jahren - durch die staatlichen Stellen zur Einführung freigegeben. Im Agendenbereich konnte auf derselben konfessionell-lutherischen Grundlage bereits im darauffolgenden Jahr eine von Christian Friedrich von Boeckh erarbeitete neue Agende vorgelegt werden. Der sogenannte „Agendenkem“ wurde Mitte 1856 per Erlaß in Kraft gesetzt. Hier war es gelungen, die leitende Norm des lutherischen Bekenntnisses durch den eng damit zusammenhängenden Rückgriff auf reformatorische Agenden nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form bis hinein in kleinste Formulierungen durchzuhalten. Herzlich danken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Bereitstellung der Personalmittel, der Ev.-Luth. Kirche in Bayern für die technische Ausstattung der Forschungsstelle sowie der Theologischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nümberg für die zur Verfügung gestellten Räume. Von großer Wichtigkeit waren wieder die vielfältigen Hilfestellungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs in Nümberg und der Universitätsbibliothek in Erlangen. Ihnen danken wir genauso wie den engagierten studentischen Hilfskräften Kerstin Hampel, Andreas Puchta und Michael Wild, die sich um das pünktliche Erscheinen dieses Bandes verdient gemacht haben. Für Unterstützungen im technischen Breich gilt unser Dank Pfarrer Konrad Müller, Vikar Johannes Hofmann und Dipl.-Geophys. Carl Tafelmeier-Witzsch. Für die Drucklegung dieses dritten Bandes der Edition haben wir wieder einen Zuschuß der Zantner-Busch-Stiftung in Erlangen erhalten. Dafür danken wir sehr. |
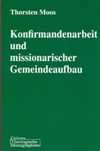 |
Thorsten
Moos Konfirmandenarbeit und missionarischer Gemeindeaufbau Calwer Verlag, 1995, 443 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3383-9 9,80 EUR |
Calwer Theologische Monographien -
Reihe C -Band 25 Dieses Buch versucht, Hoffnung zu stiften. Es greift ein Arbeitsfeld auf, das zu den tragfähigsten und zukunfts trächtigsten der Volkskirche gehört, nichtsdestoweniger aber für viele mit Frustration und Mühsal verbunden ist. Es wendet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kirche, in der verzagte Selbstbescheidung fast schon zum guten Ton gehört. In dieser Situation soll aus theologischer Besinnung und praktischer Anschauung Hoffnung erwachsen. Der Blick auf die Gegenwart Gottes zeigt, daß Konfirmandenarbeit geistliche Verheißung hat. Die Beispiele aus der Gemeindepraxis machen deutlich, daß Konfirmandenarbeit ihr Teil zum Gemeindeaufbau beiträgt. Beides zusammen zu schauen ist Aufgabe praktischer Theologie. Die Entdeckung des anstrengenden, aber verheißungsvollen Gemeindebereichs der Konfirmandenarbeit führten nach meinem zweiten Examen 1990 zur Aufnahme dieser Arbeit. Von Sommer 1991 an wurde sie begleitet, korrigiert und angespornt von der Konfirmandenarbeit in der eigenen Gemeinde. Im Sommer 1994 wurde sie von der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg als Inauguraldissertation anerkannt. |
 |
Glauben - lernen Grundlegung einer katechetischen Theologie Calwer Verlag, 1998, 380 Seiten, kartoniert, 978-3-7668-3605-2 19,00 EUR |
Glauben-lernen geschieht, wenn Menschen aufmerksam werden auf das, was im Evangelium zur Sprache kommt. Die Studie zeigt auf, daß solches Lernen nicht Belehrung der Unwissenden ist, sondern ein unabschließbarer Weg des gemeinsamen Lernens. Dieser lebendige Diskurs ist mit dem christlichen Glauben unabdingbar verbunden. Aus dieser Verbindung ergeben sich neue Perspektiven für das Ganze der Theologie, insbesondere für eine erneuerte Wahrnehmung der Kirche: Ihr Wesen ist die Bereitschaft, sich von der Geschichte Gottes mit den Menschen immer wieder neu formen zu lassen. Ihre Aufgabe ist es nicht, alte Bilder und festgefügte Vorstellungen zu vermitteln, sondern das gemeinsame Glaubenlernen zu ermöglichen. Dafür steht der Begriff der katechetischen Theologie, der die fragwürdige Alternative von traditioneller Katechetik und Religionspädagogik hinter sich läßt. Die von der Autorin vorgelegte Grundlegung einer katechetischen Theologie bringt die Wahrheitsmomente bei der Disziplinen zur Geltung und eröffnet damit neue Perspektiven sowohl für die Religionspädagogik als auch für die Praktische Theologie als ganze. |
 |
Reiner Knieling Predigtpraxis zwischen Credo und Erfahrung Homiletische Untersuchungen zu Oster-, Passsions- und Weihnachtspredigten Calwer Verlag (Stuttgart), 1999, 256 Seiten, 978-3-7668-3632-8 19,00 EUR |
Wie kann von zentralen
Glaubensaussagen so gesprochen werden, dass ihr Bezug zum
alltäglichen Leben der Gemeindeglieder deutlich wird? Eine Brücke
zwischen Bekenntnisinhalten und Erfahrung zu schlagen, gehört zu den
zentralen Herausforderungen und Schwierigkeiten der Predigt: In
manchen Predigten scheint der Erfahrungsbezug zu fehlen, in anderen
wird die Beziehung zu wichtigen Credoaussagen nicht erkennbar, in
dritten stehen Credo und Erfahrung unvermittelt nebeneinander. Unter dieser Fragestellung untersucht das Buch ausgewählte Oster-, Passions- und Weihnachtspredigten. Die Studie leitet zu einer theologisch reflektierten Predigtpraxis an und entwickelt konkrete Perspektiven, wie bekenntnisgemäß und erfahrungsbezogen zugleich gepredigt werden kann. |
 |
Geistliche Leitung als theologische Aufgabe Kirche - Pietismus - Gemeinschaftsbewegung Calwer, 2000, 620 Seiten, Broschur, 3-7668-3692-7 |
Einleitung: Vorhaben und Arbeitsweg Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Leitungsverantwortung, die im Gesamtverband der Gemeinschaftsbewegung (Evangelischer Gnadauer Gemeinschaftsverband) durch den Präses wahrgenommen wird, in ihren theologischen Inhalten zu dokumentieren, theologisch zu reflektieren, zu bilanzieren und Konsequenzen fur das Wahrnehmen von Leitungsverantwortung auf den unterschiedlichen Ebenen von Gemeinschaftsbewegung und Kirche aufzuzeigen. Diese Aufgabe ist gegenwärtig aus zweierlei Gründen besonders relevant: Innerhalb der Gemeinschaftsbewegung, dem größten freien Werk im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), sind Veränderungsprozesse unübersehbar. Stagnation und Rückgang sind, unbeschadet einzelner lokaler Aufbrüche, nicht von der Hand zu weisen. Gemeinschaftsarbeit muß sich, wenn sie zukunftsträchtig agieren will, vielerorts verändern und neu orientieren . Innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und den in ihr verbundenen 24 Landeskirchen werden gleichsam die Karten neu gemischt. Zurückgehende Mitgliederzahlen, finanzielle Einbrüche und nicht zuletzt ein nachlassender Einfluß auf die gesellschaftlichen Wirkkräfte lassen alle Verantwortlichen nach neuen inhaltlichen Konzepten und Strukturen fragen. Die vorliegende Arbeit wird zeigen, wie sich dabei der Stellenwert von Gemeinschaftsbewegung innerhalb dieser Kirchen nachhaltig verändert. |