| Buchhandlung Heesen | Versandbuchhandlung für Evangelische Theologie |
Impressum | |
| Freudenstadt / Loßburg | Datenschutzhinweise | ||
| Tel. 07446 952 418 1 | Buchhandlung.Heesen@t-online.de | ||
| Da unsere Angebote manuell erstellt werden und während des Seitenaufrufes keine Verbindung zu einer Buchdatenbank aufgebaut wird prüfen wir die Verkaufspreise bei Rechnungsstellung auf Richtigkeit und berechnen den gesetzlich festgelegten Buchpreis. Falls sich dadurch eine Preiserhöhung ergibt werden wir Sie vor Versand informieren, Sie können dann diesem Preis zustimmen oder vom Kauf zurücktreten. Hinweise zum Datenschutz und Cookies | |||
| Hexen-Hexenverfolgung | Inquisition | Teufel-Satan-Dämonen | Exorzismus |
|
Inquisition |
||
 |
Marie von Lüneburg Tyrannei und Teufel Die Wahrnehmung der Inquisition in deutschsprachigen Druckmedien im 16. Jahrhundert Böhlau Verlag, 2019, 256 Seiten, 978-3-412-51615-4 50,00 EUR |
Bis heute steht die Inquisition für die dunklen Seiten der
Geschichte: blutige Hinrichtungen, Folter und öffentliche Verbrennungen.
Im Kampf um den wahren und rechten Glauben steht die Behörde, bis heute
existierend, für institutionalisierte kirchliche Macht. Im deutschsprachigen Reich etablierte sich nach der Reformation im Gegensatz zu den europäischen Nachbarländern kein Inquisitionstribunal. Doch die deutschen Protestanten hatten durch die mediale Aufbereitung in Flugschriften und Flugblättern maßgeblichen Anteil an der öffentlichen Debatte um die Inquisition. Der Grund war offensichtlich: Die Sorge der Protestanten vor dem Übergreifen der kaiserlichen oder päpstlichen Behörden auf die deutschen Territorien. Die Ausbildung von medialen Stereotypen um die Inquisition, die bis heute in den Nachrichten kursieren, fand demnach in einem Land statt, in dem es gar keine Inquisition gab. Gespiegelt am ereignispolitischen Kontext der konfessionellen Spannungen im Verlauf des 16. und Beginn des 17. Jahrhunderts wird der Entstehung, Nutzung und Entwicklung dieser Bilder nachgegangen. |
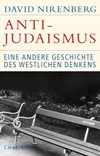 |
David Nirenberg Anti-Judaismus Eine andere Geschichte des westlichen Denkens Beck, 2. Auflage 2017, 587 Seiten, Hardcover, 978-3-406-67531-7 39,95 EUR |
Anti-Judaismus gilt als eine irrationale Abweichung vom
westlichen Denkweg hin zu Freiheit, Toleranz und Fortschritt. David Nirenberg zeigt demgegenüber in seinem aufsehenerregenden Buch anhand zahlreicher - oft erschreckender - Belege von der Antike bis heute, dass die Distanzierung vom Judentum zum Kern des westlichen Denkens und Weltbilds gehört. Die Alten Ägypter verachteten ihre jüdischen Nachbarn als Fremde, die das Land angeblich im Dienste der Perser, Griechen oder Römer unterwanderten. Für die frühen Christen und Muslime waren die Juden Feinde der von Jesus oder Mohammed verkündeten Wahrheit. Spanische Inquisitoren strebten ebenso wie protestantische Reformatoren danach, ein heimliches Judentum aufzudecken und zu zerstören, von dem sie die Christenheit bedroht sahen. Die Aufklärung räumte mit diesem Feindbild keineswegs auf. Voltaire bekämpfte in Gestalt der Juden den Aberglauben, Kant die selbstverschuldete Unmündigkeit und Marx das Privateigentum. Die Gegner mit Juden zu identifizieren hat auch ohne reale Juden funktioniert. Aber immer wieder waren Juden (und nicht nur sie) reale Opfer eines Anti-Judaismus, der die Geschichte des Westens wie ein roter Faden durchzieht. Leseprobe |
 |
Benjamin Scheller Die Stadt der Neuchristen Konvertierte Juden und ihre Nachkommen im Trani des Spätmittelalters zwischen Inklusion und Exklusion de Gruyter, 2013, 509 Seiten, Hardcover, 978-3-05-005977-8 123,95 EUR |
Europa im Mittelalter 22 Verfolgt von der Inquisition, traten im Königreich Neapel in den Jahren um 1292 tausende von Juden zum Christentum über: die einzige Massenkonversion von Juden zum Christentum außerhalb der iberischen Halbinsel und der spanischen Herrschaftsgebiete während des Mittelalters. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts sind die konvertierten Juden aber auch ihre Nachkommen in verschiedenen Regionen des süditalienischen Festlandes unter Bezeichnungen wie „Neofiti“ (von griechisch: „Neophytos“ = „Neugepflanzter“) „Christiani Novi“ bzw. „Cristiani Novelli“ belegt. Auch Generationen später wurden die Abkömmlinge der Konvertiten also als Neuankömmlinge in der christlichen Gesellschaft markiert. Sie gehörten dazu und gleichzeitig doch nicht. „Die Stadt der Neuchristen“ behandelt die Geschichte der konvertierten Juden des Königreichs Neapel und ihrer Nachkommen erstmals monographisch und nimmt die spannungsreichen Prozessen von Inklusion und Exklusion im Verlauf von über 200 Jahren in den Blick. Dabei verbindet die Studie die Makroperspektive auf das ganze Königreich mit der mikrologischen Untersuchung der Geschichte der Neuchristen in einer Stadt: dem apulischen Trani, der „Metropole“ der Neuchristen im italienischen Süden während des Spätmittelalters. Multiperspektivisch analysiert sie politische Stellung, Netzwerke, Räume, Karrieren sowie religiöse Lebensführung der konvertierten Juden und ihrer Nachkommen ebenso wie ihren Ort in der zeitgenössischen Wissensordnung des Königreichs Neapel. Gleichzeitig fragt das Buch danach, warum die Neuchristen 1495 aus Trani vertrieben wurden, Versuche, sie aus dem Königreich zu vertreiben, jedoch 1510 und 1514 scheiterten. Ein Epilog verfolgt die Gegenwart der Neuchristen von Trani in der Erinnerung bis in die unmittelbare Gegenwart. Inhaltsverzeichnis |
 |
Jörg Oberste Ketzerei und Inquisition im Mittelalter Wissenschaftliche Buchgesellschaft / Herder Verlag, 2012, 150 Seiten, Softcover, 978-3-534-24568-0 22,00 EUR |
Ketzerei und Inquisition im
Mittelalter Schon immer versuchte die Kirche, ihre Lehre von abweichenden Ansichten rein zu halten. Häresie und Ketzerei sind daher ein Bestandteil des Christentums von Anfang an. Jörg Oberste gibt einen knappen Überblick über alle Spielarten der Häresie von den Anfängen der Kirche bis ins Spätmittelalter. Und er dokumentiert auch die unterschiedlichen Spielarten der Reaktion der Kirche auf abweichende Ansichten und Bewegungen. Inhaltsverzeichnis |
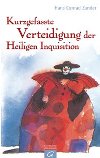 |
Hans Conrad Zander Kurzgefasste Verteidigung der Heiligen Inquisition Gütersloher Verlagshaus, 2007, 192 Seiten, Gebunden, Schutzumschlag, 978-3-579-06952-4 14,95 EUR |
Warum die Heilige Inquisition gut ist: eine janusköpfige Satire in 5 Kapiteln - Ein Lesevergnügen für alle, die religiöse Satire zu schätzen wissen - Eine Pflichtlektüre für alle Zander-Fans Hätte es Papst Pius V. nicht gegeben, würde die Christenheit heute nicht mehr existieren. Er allein hat nämlich verhindert, dass Rom, und damit ganz Europa, von den Muslimen erobert wurde. Ohne ihn würden vermutlich Alice Schwarzer und Angela Merkel heute mit einem Kopftuch oder gar in einer Burka herumlaufen. Hat die Heilige Inquisition dafür nicht unseren tief empfundenen Dank verdient? Hans Conrad Zander, der Großmeister der religiösen Satire, erweist nun endlich diesen überfälligen Dank: Er macht geneigten Zeitgenossen klar, was die Heilige Inquisition war: jung und fortschrittlich, frauenfreundlich, effizient, im Recht und eben heilig... Leseprobe |
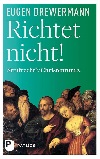 |
Eugen
Drewermann Richtet nicht! Patmos Verlag, 2021, 816 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, 14 x 22cm 978-3-8436-1215-9 42,00 EUR |
Strafrecht und Christentum, Band 2 Eigentlich weiß es jeder: Fehlbare Menschen können nicht über die Fehler anderer zu Gericht sitzen. Ist wenigstens Gott gerecht? Gott sei Dank nicht! Der Kern der Botschaft Jesu lautet vielmehr: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldnern«. Wie gewinnen wir diese Einsicht im Rahmen unseres Strafsystems zurück? Dazu untersucht Eugen Drewermann in diesem Band Vorstellungen des Strafrechts im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Im Mittelalter haben Papst und Kaiser aus »Gott« ein Mittel ihres Machterhalts gemacht, und beide scheiterten. Das Reich zerfiel in Fürstentümer und Nationalstaaten; die Kirche versuchte die Herrschaft über ihre Gläubigen durch Angst zu erhalten. Die Inquisition nötigte zu Denunziation, Folterverhör und Ketzerverbrennung; die Hexenfurcht, geboren aus der Angst vor Gott, dem Teufel und der eigenen Seele, hielt das Strafrecht auch der Staaten fest im Griff. Erst die Befreiung des Politischen aus den Händen der Kirche ermöglichte eine gewisse Humanisierung des Strafens. Doch auch die Gerechtigkeit der staatlichen Gesetze wird uns Menschen nicht gerecht. Nur wenn wir die Gesetzlichkeit durch Güte überwinden, finden wir zu uns selbst zurück. Leseprobe |
 |
Jörg Feuchter Ketzer, Konsuln und Büßer Mohr Siebeck, 2007, 630 Seiten, Leinen, 978-3-16-149285-3 129,00 EUR |
Spätmittelalter
und Reformation Band 40 Die städtischen Eliten von Montauban vor dem Inquisitor Petrus Cellani (1236 / 1241) Im Jahr 1241 verurteilte der Dominikanerinquisitor Petrus Cellani über 250 Einwohner der Stadt Montauban (Südfrankreich) für ihre Kontakte zu katharischen und waldensischen Ketzern. Betroffen war vor allem die konsularische Elite der Stadt, die dadurch in eine Bußgruppe verwandelt wurde. Gleichwohl überstand diese Gruppe das Verfahren und seine Folgen ohne politischen und sozialen Positionsverlust. Jörg Feuchter verfolgt den Weg der Montalbaner Eliten von der Stadtgründung (1144) über ihre Berührung mit den beiden Häresien, ihre kollektive Strategie des Umgangs mit der Inquisition bis hin zu ihrer religiösen Neuformierung unter rechtgläubigen Vorzeichen in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. Dabei entsteht ein unerwartetes Bild der Opfer einer mittelalterlichen Ketzerverfolgung. |
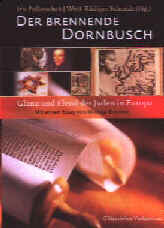 |
Iris Pollatschek / Wolf - Rüdiger Schmidt Der brennende Dornbusch Glanz und Elend der Juden in Europa Gütersloher Verlagshaus, 2004, 224 Seiten, Gebunden, 3-579-06501-7 978-3-579-06501-4 19,95 EUR Buch zur Fernsehsendung Mai 2005 im ZDF |
Die Ermordung der
Juden bedeutete den Bankrott des europäischen
Humanismus. Die Geschichte der Juden ist geprägt von
Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung. Doch das ist nur
die halbe Wahrheit: Die Geschichte der Juden kennt auch
goldene Zeitalter, blühende Gemeinden und sagenumwobene
Königreiche. Es ist auch die Geschichte von großen Frauen und Männern - Fürsten und Abenteurern, Gelehrten und Poeten, Händlern und Träumern. Eines steht fest: Ohne die Juden wäre Europa ein anderer Kontinent. Ohne sie hätten Mittelalter, Renaissance, Reformation, Aufklärung und Moderne ein anderes Gesicht. Das Buch zeigt, welchen Anteil die Juden an der abendländischen Zivilisation haben. Es legt die Wurzeln des Antisemitismus frei und schildert Blütezeiten und Wendepunkte im Leben der Juden in Europa. Sechs historische Figuren stehen beispielhaft im Zentrum und öffnen den Zugang zu wichtigen Epochen europäisch-jüdischer Geschichte. Der biographische Fokus wechselt sich jeweils ab mit allgemeineren Hintergrundkapiteln; vorangestellt ist ein umfassender historischer Essay von Michael Brenner. "Die Geschichte des Judentums und seine Bedeutung in der Entwicklung des europäischen Kulturraumes." Teil 1: Von der Antike bis zur Renaissance Flavius Josephus - mit dem Chronisten des Untergangs des jüdischen Staates erleben wir die Zerstörung des Tempels in Jerusalem und entdecken das größte Zentrum jüdischen Lebens im antiken Europa - Rom. Juden, Christen, Muslime - Die Geburt des Abendlandes Raschi - Rabbi Schlomo Ben Jitzchak, einer der größten jüdischen Gelehrten des europäischen Mittelalters, zeigt uns die legendären jüdischen Gemeinden des Rheinlandes und ihre Vernichtung während der Kreuzzüge. Die Vertreibung der Juden aus Europa Das geheime Netzwerk der Dona Gracia Mendes - die zwangsgetaufte Jüdin aus Portugal nimmt uns mit auf ihre abenteuerliche Flucht vor der Inquisition quer durch das Europa der Renaissance. Europa im Aufbruch Teil 2: Neuzeit, Aufklärung und Moderne Der Baal Schem Tow und der Funke des Chassidismus - im Osteuropa des 18. Jh. erleben wir den Aufstieg eines einfachen Synagogendieners zum Begründer der größten Erneuerungsbewegung des Judentums. Die Juden im Zeitalter der Aufklärung Moses Mendelssohn - mit dem Aufklärer und Philosophen verlassen wir Ende des 18. Jh. das Ghetto und machen uns auf den Weg ins gelobte Land des Fortschritts und der Vernunft. Das Europa der Moderne Theodor Herzl - Der Visionär des Staates Israel Hölle Europa |
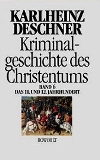 |
Karlheinz Deschner 11. und 12. Jahrhundert. Von Kaiser Heinrich II., dem "Heiligen" (1002), bis zum Ende des Dritten Kreuzzugs (1192) Rowohlt, 1999, 656 Seiten, Gebunden, 978-3-498-01309-7 27,00 EUR |
Kriminalgeschichte des Christentums
Band 6 Band 6 der "Kriminalgeschichte des Christentums" behandelt das Hochmittelalter, also das 11. und 12. Jahrhundert. Zentrale Herrschergestalten der Epoche sind: der letzte Ottone Kaiser Heinrich II., der Heilige, mit seinen drei großen Kriegen an der Seite von Heiden gegen deas katholische Polen, der Salier Heinrich IV. sowie der Staufer Friedrich O. Barbarossa. Der folgenschwere Pontifakt Grgors VII. (1073 - 1085), eines aggressiven "heiligen Satans", führt im berüchtigten Investiturstreit - Stichwort: Canossa - zum Sieg des Heiligen Stuhls über den Kaiserthron. Die Ecclesia militans et triumphans spiegelt sich im vergossenen Blut von Millionen, die sie zu den drei Kreuzzügen aufhetzt. Deschner seziert ebenso unbestechlich den barbarischen Wendenkreuzzug von 1147, überhaupt die Heidenmission, die päpstliche Ostpolitik, die rasch wachsenden "Ketzer"-Bewegungen, die beginnende Inquisition. |
 |
Uwe Birnstein Toleranz und Scheiterhaufen Das Leben des Michael Servet Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 96 Seiten, kartoniert, 12,3 x 20,5 cm 978-3-525-56012-9 18,00 EUR |
2011 jährte sich der Geburtstag des spanischen Universalgelehrten Michael Servet zum 500. Mal. Anders als kirchliche Theologen und Vorbilder hat der Humanist Servet keine Lobby, die an ihn erinnern möchte. Denn Servet wurde 1553 in Genf als Ketzer verbrannt. Die Anklage: Er hatte die Dreieinigkeit Gottes bezweifelt. Zur Ergreifung Servets hatte der Genfer Reformator Johannes Calvin wesentlich beigetragen. Aber auch andere Reformatoren unterstützten die Hinrichtung des Ketzers – sogar der besonnene Philipp Melanchthon, Mitstreiter Martin Luthers, meinte, mit der Hinrichtung Servets sei der Nachwelt „ein frommes und denkwürdiges Beispiel gegeben“.Seine trinitätsfeindliche Einstellung hatte Servet gut begründet: Der in Spanien geborene Arzt war nicht nur vom Geist des Humanismus beseelt; die lange Geschichte des enorm produktiven – und dann durch die spanische Inquisition gewaltsam beendeten - Religionsfriedens zwischen Juden, Christen und Muslimen in Andalusien hatte ihn nach Möglichkeiten suchen lassen, den Frieden zwischen den Religionen wiederherzustellen. Seiner Meinung nach stand die biblisch nicht belegte christliche Trinitätslehre dem Religionsfrieden im Weg. Uwe Birnstein schildert unterhaltsam und verständlich das Werk, das Leben und den Tod Michael Servets, geleitet von der Frage: Warum musste er sterben? Die Geschichte Servets zeigt zweierlei: Auch die Reformation hinterließ eine blutige Spur in der Kirchengeschichte. Und: Für die aktuelle globale Friedensdiskussion gibt die Theologie des Michael Servet wichtige Impulse. |
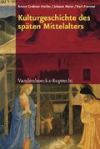 |
Grabner-Haider / Maier / Prenner Kulturgeschichte des späten Mittelalters Von 1200 bis 1500 n. Chr. Vandenhoeck & Ruprecht, 2012, 288 Seiten, Gebunden, 978-3-525-53038-2 70,00 EUR |
Die Autoren geben einen breiten
Überblick über die Kultur und Lebenswelt des späten Mittelalters
(1200 1500) in ganz Europa. Den ideellen Hintergrund bildet die
Pragmatische Philosophie von W. James bis R. Rorty, die Denkmodelle
und Weltdeutungen im Kontext konkreter "Lebensformen" und
"Lebenswelten" beschreibt. Grabner-Haider stellt die Lebenswelten und die sozialen Prozesse dieser Zeitepoche dar, Handel, Arbeit und Wirtschaft, die Beziehungen der Geschlechter. Neben den politischen Entwicklungen in Mitteleuropa, in England und Frankreich, in Nord-, Süd- und Osteuropa liegt ein Schwerpunkt auf den religiösen Weltdeutungen, dem Wirken der Bettelorden, der Herrschaft der Kleriker, den Lehren der Konzile und den religiösen Lebensformen. Im Kontrast dazu stehen die Lehren der Theologen und Philosophen an den Universitäten, die Konzepte der Humanisten und der Renaissance der antiken Lebenswelt. Grabner-Haider beschreibt die Konfliktfelder zwischen Juden, Christen und Moslems, die Entwicklung der Naturwissenschaft, der Medizin, der Mathematik und der Astronomie. Ein Blick fällt auf die Lebenswelt der Byzantinischen Kultur, die Expansion des Osmanischen Reiches, die griechisch-orthodoxe Religion in Süditalien und die Entwicklungen in Russland. Erinnert werden auch die dunklen Seiten der christlichen Reichsreligion, die Verfolgung der "Ketzer" und "Häretiker", die Formen der Inquisition und der Kampf gegen die Kirchenreform. Johann Maier stellt die Kultur und Lebenswelt der Juden in Europa und in den islamischen Ländern umfassend dar, die religiösen Lehren, die Formen des Kults und die theologischen Überlegungen. Ebenso beleuchtet Karl Prenner die Kultur und Lebenswelt der Moslems im arabischen und im persischen Raum, den Austausch mit Juden und Christen in Spanien, die theologischen und philosophischen Lehren, die Schulen des Rechts, sowie die Formen der Herrschaft. Eine übersichtliche Zeittabelle, eine Liste mit weiterführender Literatur und ein Personenregister ... |
 |
Dietmar Mieth Meister Eckhart Beck, 2014, 298 Seiten, broschiert, 12,4 x 19,4 cm 978-3-406-65986-7 16,95 EUR |
Meister Eckharts Faszination ist nicht nur für diejenigen spürbar, die sich mit neuen religiösen oder interreligiösen Impulsen beschäftigen. Er stößt auch darüber hinaus auf geistiges, literarisches und religionskritisches Interesse. Der Dominikaner Meister Eckhart (ca. 1260–1328) lehrte wie Albertus Magnus am Studium Generale der Dominikaner in Köln, aber auch zweimal, wie Thomas von Aquin, auf dem theologischen Lehrstuhl in Paris (1303/04 und 1311–1313). Man zählt ihn als Philosophen zu der Deutschen Albert-Schule, die eine Reihe von vorzüglichen Denkern hervorgebracht hat. Eckhart, der „magister sacrae scripturae“ (Professor der Heiligen Schrift), hat eine eigenständige Philosophie und Theologie entwickelt, die schon damals viele faszinierte und immer wieder neu entdeckt wurde. Seine letzten Jahre in Köln waren von einem Inquisitionsprozess überschattet, der gegenüber einem derart renommierten Lehrer der Theologie einzigartig war. Denn es ging dabei nicht primär um akademische Streitigkeiten, sondern um die pastorale Wirkung seiner deutschen Predigten und Schriften im Zusammenhang mit der Verfolgung von sog. „Freigeistern“, aber auch der „Beginen“, also religiös lebender Frauengemeinschaften. Dietmar Mieth versucht, Eckharts Profil als Denker, als Prediger und als Lebenslehrer darzustellen. Er sieht in ihm nicht einfach ein historisches Phänomen, sondern einen Vorausdenker. Zudem bezieht Mieth soziale Zusammenhänge, insbesondere die damaligen religiösen Frauenbewegungen, mit ein. Und nicht zuletzt nimmt er Stellung zu Eckharts Lehrkonflikt. |